Wie ein Appell kommt schon der Titel daher: „Rettet die Nachrichten!“, ruft uns Marco Bertolaso entgegen, seines Zeichens Nachrichtenchef des Deutschlandfunks. Und das ist auch seine Forderung an die Gesellschaft: Nicht nur die Redaktionen, sondern alle – Politik, Wirtschaft, Verbände und die Bürgerinnen und Bürger – müssen ihren Beitrag dazu leisten. In den Mittelpunkt seines Buches stellt er eine schonungslose Analyse des Nachrichtenjournalismus.
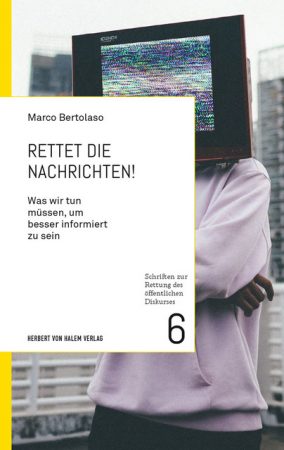
Bertolaso benennt Funktionen und Aufgaben, aber auch aktuelle Probleme und Schwächen, und scheut sich dabei nicht, Finger in die Wunden zu legen und hausgemachte Probleme zu benennen. Das Vertrauen in die traditionellen Nachrichten sei verloren gegangen, diagnostiziert er, viele Menschen würden sich in den gewählten Themen nicht wiedererkennen. Natürlich geht Bertolaso auch auf Trends ein, die diese Entwicklung begünstigen. Stimmen u.a. aus der Politik, die Misstrauen gegen die traditionellen Medien fördern (Stichwort: Fake News), sogenannte soziale Medien wie Facebook oder Twitter, die von Interessen großer Konzerne geleitet sind, und bei vielen Menschen längst die Nutzung klassischer Nachrichten verdrängt haben – was dazu führt, das sie sich nur noch in selbstgewählten Blasen bewegen und alles außerhalb dieser Welt schnell als Lügenpresse diffamieren. So entsteht Krawall, der natürlich Klickzahlen generiert, aber Information und sachliche Diskurse verhindert.
Bertolaso stellt in dieser Analyse alle wichtigen Fragen der nachrichtenjournalistischen Gegenwart und erweist sich darin als intelligenter Experte, der sein Buch auch mit spannenden Innenansichten bereichert. Etwas vage bleibt er jedoch in der Skizze seiner Vision, wie Nachrichten künftig krisenfest sein und bei Skeptikern die Glaubwürdigkeit wiedergewinnen könnten. Das von ihm propagierte Konzept „realistischer Nachrichten“ bewegt sich auf dünnem Eis, etwa, wenn er das Auswahlprinzip der Relevanz aufgibt und durch einen Wahrhaftigkeitsanspruch ersetzt. Da kommen Fragen auf, die er nicht beantwortet: Wie können Nachrichten, die notwendigerweise manchmal verkürzen und vereinfachen müssen, alle Blickwinkel auf komplexe Sachverhalte abdecken? Wie sollen wichtige Themen wie das Sichtbarmachen des Einflusses von Lobbyisten auf das politische Geschehen in die Nachrichten integriert werden, wenn der dafür notwendige Platz nur in der Hintergrundberichterstattung vorhanden sein dürfte? Wie konkret kann der Trend zu Infotainment gebrochen und mehr Komplexität in den Nachrichten erreicht werden? Wie können in den ohnehin überlasteten und tendenziell schrumpfenden Nachrichtenredaktionen die von Bertolaso angemahnten fehlenden Themen recherchiert werden, die zur Abbildung von Wirklichkeit dazugehören, aber von den Nachrichtenagenturen nicht abgedeckt werden – ohne dass dabei andere wichtige Themen unter den Tisch fallen?
Mit seiner Forderung nach Nachrichten, die nach den Grundprinzipien von Gründlichkeit, Exaktheit, Fairness, Transparenz und Unabhängigkeit erstellt werden, dürfte der Autor fast überall auf offene Ohren stoßen. Wenn man die Deutschlandfunk-Nachrichten, die „Tagesschau“ oder andere Nachrichten der öffentlich-rechtliche Medien oder der Qualitätszeitungen hört, sieht oder liest, hat man grundsätzlich und bei aller berechtigten Kritik dennoch das Gefühl, dass die dort Arbeitenden diese Prinzipien verinnerlicht haben. Den sogenannten Querdenkern, die sich ausschließlich über ihre Facebook-Blase informieren, müssen diese Redaktionen nicht entgegenkommen, sondern sollten ihnen bestmögliche Qualität entgegensetzen. Vielleicht mit Hilfe des alten Grundsatzes „Zuverlässigkeit geht vor Schnelligkeit“, der im Zeitalter von Internet und Twitter leider allzu oft in Vergessenheit gerät, weil auch „Tagesschau“, „Süddeutsche Zeitung“ und Deutschlandfunk gern als erste mit einer Eilmeldung auf dem Markt sein wollen – selbst wenn die Quellenlage noch sehr dürftig ist.
Marco Bertolaso: Rettet die Nachrichten! Was wir tun müssen, um besser informiert zu sein. Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses 6, Herbert von Halem Verlag, Köln, 356 Seiten, 25 Euro.


