Extrem rechte Akteur*innen verbreiten mit Internet-Memes politische Inhalte und nennen das Informationskrieg. Die Amadeu Antonio Stiftung untersucht in einer neuen Broschüre Memes als politisches Phänomen der extremen Rechten. Die Broschüre zeigt, was diese Form der Propaganda so reizvoll macht und gibt Handlungsempfehlungen.
#stolzmonat lautete ein vielfach geteilter Hashtag im vergangenen Juni. Dahinter steckte eine queerfeindliche und nationalistische Kampagne, die sich als vermeintliches Gegenstück zum Pride-Monat der LGBTQIA+-Bewegung präsentierte. Die zahlreichen und oft mit kleinen schwarz-rot-goldenen Flaggen versehenen Beiträge fluteten in diesem Monat die sozialen Medien. Mehrere Tage führte der Hashtag sogar die Charts bei X (ehemals Twitter) an.
„Mitmachfaschismus“ nennt die neue Broschüre „Kreative, ans Werk!“ das Phänomen der konzertierten Produktion von extrem rechten Bild- und Text-Arrangements im Netz — den Memes. Die Broschüre wurde von der Amadeu Antonio Stiftung und dem Forschungsverbund „Meme, Ideen, Strategien rechtsextremistischer Internetkommunikation“ (MISRIK) herausgegeben.
„Bio-Waffen im Informationskrieg“
Mit der rund 40-seitigen Broschüre widmen sich die Autor*innen der Macht der Bilder im Internet, die Rechtsextreme zweifellos erkannt haben. Sie verstehen ihre Publikation „als Ressource für alle, die sich über rechtsextreme Strategien informieren und sie durchkreuzen möchten“. In fünf Kapiteln gehen sie zunächst der Begriffsklärung extrem rechter Memes nach. Das Meme stellen sie als ein Kommunikationsmittel heraus, das Menschen mit einer Idee anstecken soll. Das besondere an extrem rechten Memes sei, dass sie eher bereits existierende Ressentiments – zum Beispiel rassistische oder queerfeindliche – hervorlocken würden, als diese ganz neu zu verbreiten.
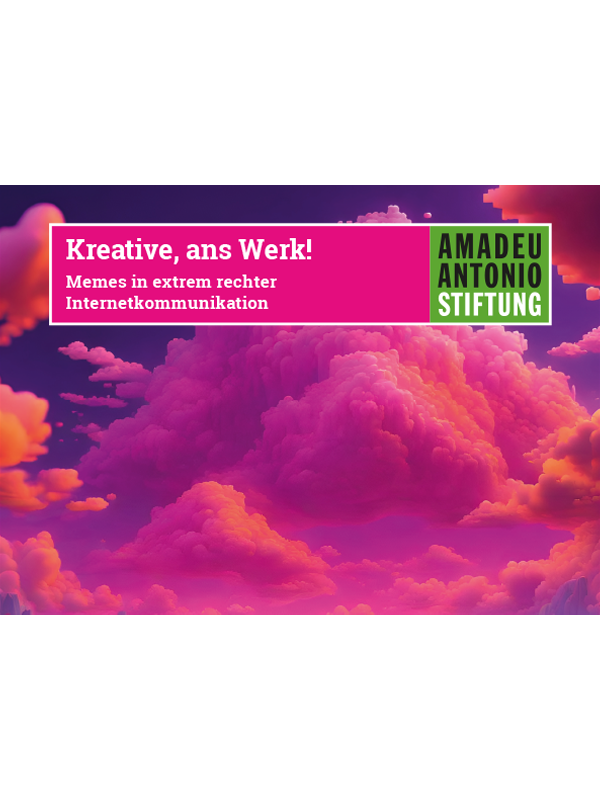
Dazu zitiert die Broschüre den Publizisten Nils Wegner, der Memes in einem Beitrag in dem neurechten Magazin „Sezession“ als „Bio-Waffen im Informationskrieg“ bezeichnet. Wie bei biologischen Massenvernichtungswaffen könnten sich durch weitergetragene Memes rechte Ideologien virenähnlich verbreiten. Die Broschüre macht allerdings auf einen wichtigen Unterschied aufmerksam: Es ist nicht das Virus, das sich selbst verbreitet, sondern es sind Menschen, die die Inhalte teilen.
Die Autor*innen betrachten extrem rechte Memes auch als eine Praxis digitaler Kommunikation. Dazu werten sie Interviews mit extrem rechten Aktivist*innen und sogenannten Trollen aus. Sie zeigen, dass mit den oft humoristischen Memes einerseits Gemeinschaft erlebt werden kann. Denn wer die Codes erkennt und teilt, kann mitmachen. Andererseits sind sie ein Mittel, um Diskurse über die eigene Szene hinaus zu beeinflussen. Damit zeigt die Broschüre, dass sich die Memepraxis nahtlos an die Strategien der extremen Rechten anschließt — es geht darum, die gesellschaftliche Mitte zu radikalisieren. Abschließend zeigen die Autor*innen Wege auf, wie die demokratische Öffentlichkeit im Internet auf solche Memes reagieren kann.
Neue Zielgruppe für Memes
Die Stärke der Broschüre liegt darin, den gemeinschaftlichen Charakter von extrem rechten Memes herauszuarbeiten. Denn die extrem rechten Akteur*innen erkennen in Nutzer*innen sozialer Plattformen zwei Dinge: einerseits sind sie Empfangende von Memes, andererseits können sie sehr schnell mitmachen. Indem sie Inhalte verbreiten und mit ein paar Klicks selbst herstellen können, sind sie potentielle Aktivist*innen.
Die Gefahr dieser Form der Propaganda liegt darin, dass extrem rechte Memes sich oft erst im Kontext als solche erkennen lassen. Ohne Wissen darüber können Menschen ihnen in sozialen Medien auch nicht widersprechen oder diese an geeigneter Stelle zur Anzeige bringen.
Die Zielgruppe von extrem rechten Memes liegt nicht vordergründig im rechtsextremistischen Spektrum. Den rechten Akteur*innen geht es darum, die gesellschaftliche Mitte mit ihren Inhalten zu erreichen. Daran zeigt die Broschüre, dass Memes zu einem Werkzeug im rechtsextremen Kulturkampf werden. Das Ziel ist es, Menschen unbemerkt zu beeinflussen und eine kulturelle Hegemonie zu erschaffen, damit Menschen Alltagssituationen sozusagen „aus rechter Sicht“ bewerten. Erst im zweiten Schritt geht es ihnen darum, mit einer extrem rechten Partei beispielsweise Wahlen zu gewinnen. So nutzen rechte Akteur*innen auch die Netzkultur. Mit den Memes werden antidemokratische und menschenfeindliche Botschaften gestreut. Die Memes können alle erreichen, ob in rechten Internetforen oder im privaten Familienchat.
Broschüre als Pdf herunterladen



