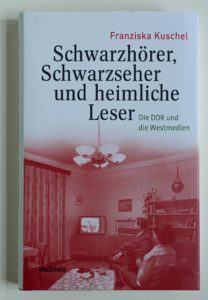Unter dem Titel „Schwarzhörer, Schwarzseher und heimliche Leser“ untersucht Franziska Kuschel die Strategie der DDR, den Konsum der Medien aus der Bundesrepublik zu verhindern oder wenigstens zu kontrollieren und einzudämmen. Das galt vor allem in den 1950er und 60er Jahren, wo die Seher_innen von Westfernsehen als geistige Grenzgänger kriminalisiert wurden. In der DDR waren sogar Hans-Joachim Kulenkampff-TV Shows und auch das christliche „Wort zum Sonntag“ als gefährliche Indoktrination eingestuft. Dabei konnten rund 85 Prozent der DDR-Bürger das Westfernsehen empfangen. Die große Ausnahme waren Teile in Sachsen und Dresden – im „Tal der Ahnungslosen“.Die Autorin Franziska Kuschel, 1980 in Lübz in der DDR geboren, promovierte 2015 an der Humboldt-Universität Berlin. Sie hatte sich bereits in ihrem Studium wie auch als Referentin der Enquetekommission zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur des Brandenburger Landtags mit der Medienpolitik der DDR beschäftigt. Im Vorwort schreibt die Autorin: „Die Ost-Berliner Partei und Staatsführung beanspruchte, die öffentliche Kommunikation in der DDR vollständig zu kontrollieren. Dabei spielten Medien für die SED-Spitze eine zentrale Rolle: Sie sollten bei der Durchsetzung des Herrschaftsanspruchs und der Machtsicherung helfen, insofern sie ein wichtiges Mittel waren, die eigenen Ideen zu verbreiten, die Menschen zu mobilisieren und zu erziehen.“ – So die SED mit ihrer Begründung in der Tradition von Lenin.
Das änderte sich nach der Ablösung von Walter Ulbricht durch Erich Honecker. Die Autorin zitiert Honecker, der im Mai 1973 im Zentralkomitee sagte, dass „ jeder bei uns nach Belieben“ die Hörfunk- und TV-Programme der Bundesrepublik ein und ausschalten könne. Doch diese Äußerung habe zur Verwirrung im Lande beigetragen. Nun habe keiner gewusst, was erlaubt oder verboten war. Auch wenn man im Hause die Bundesliga sah, sei es strikt verboten gewesen, seinen Nachbarn einzuladen oder davon am Arbeitsplatz den Kolleg_innen zu erzählen. Die Bürger gerieten sofort in Gefahr, wegen der Verbreitung „staatsfeindlicher Hetze“ vor ein Gericht zu kommen und verurteilt zu werden. Die „geheimen Verführer aus dem Westen“ haben nie als harmlos gegolten. Nach Auffassung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) konnte jede Hörfunk- und Fernsehsendung im Sinne der politischen wie ideologischen Diversion wirksam werden.
Ob es nun nach Franziskas Kuschel allein die DDR-Medien und ihre staatlich verordnete Medienpolitik allein war, die zur Erosion des Sozialismus und zum Untergang der DDR beitrugen, müsste noch untersucht werden. Mit diesem Band erhalten die Leser_innen auf jeden Fall Einblick in den Kontrollwahn der DDR.