Ein „Jahrebuch“ hat Birk Meinhardt vorgelegt. Aus seiner persönlichen Sicht erzählt der 61jährige Egon-Erwin-Kisch-Preisträger von seinen Anfängen als erster „Ostler“ in der Redaktion der „Süddeutschen Zeitung“ bis zur Kündigung seines SZ-Abonnements im Jahr 2019. Es ist eine fortschreitende Desillusionierung. Meinhardt arbeitet sich am Erlebten ab. Er reflektiert, spekuliert, zweifelt, leidet und wütet. Eine „Selbstbefragung“ und „riesige Entblößung“.
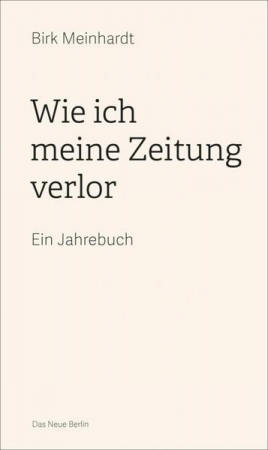
Stark, mutig – und angreifbar, weil es eben nicht nur um Meinhardts eigene Geschichte und seine persönliche Sicht geht, sondern auch um Ost und West und – nicht zuletzt – um die Glaubwürdigkeit der Medien. „Ich schreibe weiter über den Journalismus, indem ich weiter nur über mich schreibe“, heißt es auf Seite 130.
Meinhardt ist in Berlin-Pankow geboren und in der DDR aufgewachsen. Das Leben im Ostblock und die Erfahrungen als junger Journalist haben ihn sensibilisiert. Den Zusammenbruch des Systems erlebt zu haben, sieht er als Privileg, die Wende als Chance. Genau hinschauen und schreiben, was ist, um zu begreifen. Meinhardt will nichts mehr als gegeben hinnehmen, sich nicht noch einmal in eine irgendwie geartete Einheitsfront einreihen. „Ich habe mit mir abgemacht, ungesunde und mich ewig beschäftigende Kompromisse nicht mehr einzugehen.“ Damals ahnt er vermutlich noch nicht, dass die Freiheit im Westen nicht grenzenlos ist und auch dieses System – viel subtiler – „Anpassungsleistungen“ verlangt.
Vier bisher unveröffentlichte Zeitungstexte, allesamt lesenswert, sind in seinem „Jahrebuch“ abgedruckt. Man kann sie als Meilensteine eines langen und schmerzhaften Trennungsprozesses sehen. 1999 schreibt Meinhardt für die SZ-Sportredaktion über Thomas Emmrich, den herausragenden Tennisspieler der DDR, der nie im Westen aufschlagen durfte. Der Text ist für eine Sonderseite eingeplant, erscheint ihm damals aber selbst „unpassend“. Im Jahr 2004 ist Meinhardt Reporter der Seite Drei und Streiflicht-Autor. Zweimal hat er für die SZ den Kisch-Preis gewonnen, genießt Ansehen und Privilegien. Seine Recherche über die Deutsche Bank und die Machenschaften der Investmentbanker dauert drei Monate. Gegen die zweiteilige Reportage legt der Chef des Wirtschaftsressorts sein Veto ein. Meinhardt antwortet in einer Mail: „Für Sie liegt das Problem in der notwendigen Umstrukturierung der Deutschen Banken. Für mich liegt es im Nicht-Funktionieren des ganzen Gewerbes, und, noch einmal, im Verlust jeglicher Moral. Alles geht weit über irgendein einzelnes Missmanagement hinaus.“ Vier Jahre später, am 15. September 2008, bricht das Bankhaus Lehmann Brothers zusammen.
2010 untersucht Meinhardt akribisch die Fälle von zwei zu Unrecht verurteilten Neonazis. Gibt es so etwas wie eine reflexhafte Vorverurteilung rechter Straftäter durch die Medien? Beeinflusst die öffentliche Meinung die Polizeiarbeit und die Justiz? Vieles deutet darauf hin. Beide Männer werden zwar später freigesprochen, aber ihr Leben liegt in Trümmern. Der Ressortleiter bittet Meinhardt, auf den Part mit dem prominenten TV-Moderator, der im Beitrag genannt wird, zu verzichten, weil er ihn kürzlich auf einer Silvesterfeier getroffen hat. Meinhardt weigert sich, weil die Geschichte unvollständig wäre. Schließlich hebelt der Stellvertretende Chefredakteur die Geschichte mit einem Argument aus, das mit journalistischen Grundsätzen nichts mehr zu tun hat. Die Reportage könne, so zitiert Meinhardt ihn, von Rechten als Beleg für ihre ungerechtfertigte Verfolgung vereinnahmt werden.
2010 entscheidet sich der Kisch-Preisträger für eine journalistische Auszeit. Er will Romane schreiben, Texte, die bis zum Druck „nur ihm gehören“. Das in jeder Zeitung übliche Redigieren empfindet er inzwischen „als eine Art Enteignung“. 2012 kündigt er, will nur noch Schriftsteller sein und vertieft sich in die Arbeit an seiner Familiengeschichte „Brüder und Schwestern“. 2017 ist er „ausgebrannt“ und arbeitet ein letztes Mal als Reporter für die SZ. Seine Geschichte über die US-Militärbasis Ramstein veröffentlicht er in dem vorliegenden Buch. Weitere Reportagen kommen nicht zustande.
Im Lauf der Jahre hat sich Meinhardts Blick verändert. Ihm fällt auf, „wie einseitig die gesamte Berichterstattung geworden ist. Das ist ja alles nur noch in eine Richtung gebürstet! Das ist ja ein Dauerzustand geworden: einer Haltung Ausdruck zu verleihen und nicht mehr der Wirklichkeit.“ Er kritisiert das „Aussperren von Wirklichkeit“, prangert das Weglassen, Hervorheben und Vereinfachen an, das ständige Bestätigen und Wiederholen der Mehrheitsmeinung, das mit dem Bemühen auf der „richtigen Seite“ zu stehen einhergeht. Genau darin sieht er eine der Ursachen für die zunehmende Radikalisierung der Gesellschaft. „Wieso begreifen sie nicht, dass sie ohne Unterlass mit erzeugen, was sie so dröhnend verdammen?“
Die SZ weist Meinhardts Darstellung entschieden zurück, heißt es in einer Stellungnahme, die der Bayerische Rundfunk mit einer Erwiderung des Autors auf seiner Internetpräsenz veröffentlicht hat. Wie nicht anders zu erwarten, hat jede Seite ihre eigene Sichtweise. Wichtiger als die Diskussion darüber, wie es nun wirklich war, ist allerdings das Nachdenken darüber, was wir als Journalist*innen besser machen können.
Birk Meinhardt: Wie ich meine Zeitung verlor. Ein Jahrebuch, Verlag Das neue Berlin, Berlin 2020, 144 Seiten, 15,00 Euro, ISBN 978-3-360-01362-0


