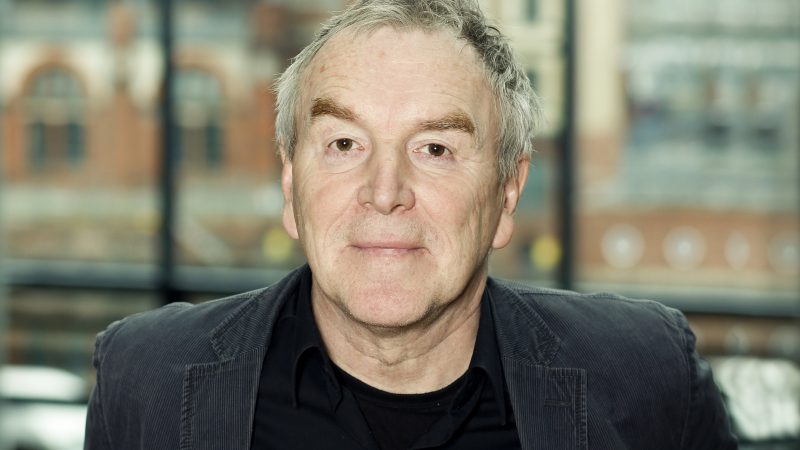Meinung
Das Ende aller Verlegerträume von Subventionsmilliarden hatte sich allerdings schon vor dem finanzpolitischen Desaster der Regierung abgezeichnet. Seit fünf Jahren hatte die Verlegerlobby, vor allem der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger BDZV, massiven Druck erst auf die CDU-SPD-GroKo, später auf die Ampel ausgeübt. Ohne Staatsknete, so ließ der BDZV sich von einer Studie der Unternehmensberatung Schickler bescheinigen, werde die Zeitungszustellung bereits 2025 in rund 40 Prozent aller deutschen Gemeinden nicht mehr rentabel abzuwickeln sein.
Frage der Zuständigkeit
Die Drohung zeigte zunächst Wirkung. Satte 220 Millionen Euro Fördermittel für die Verlagsbranche, speziell für die „Förderung der digitalen Transformation“ sah 2020 ein Corona-Nachtragshaushalt vor. Es folgte ein öffentlicher Hickhack, an dessen Ende sogar eine Verfassungsbeschwerde digitaler Startups wie „Krautreporter“ drohte. Wegen mutmaßlicher Verletzung der Pressefreiheit durch Verzerrung des publizistischen Wettbewerbs – schließlich sollten kleine Digitalunternehmen außen vor bleiben. Noch vor den Wahlen 2021 wurde das Projekt stillschweigend von der Agenda gestrichen.
Nichtsdestotrotz feierte es im Koalitionsvertrag der Ampel überraschend eine Wiederauferstehung. Man habe vor, „die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen zu gewährleisten“, hieß es da vollmundig. Und ein vom Bundeswirtschaftsministerium beauftragtes Gutachten erkannte im Frühjahr 2023 die Zustellförderung für bestimmte Printmedien als wirtschaftlich sinnvoll und verfassungskonform an.
Gleichwohl zeigte Wirtschaftsminister Robert Habeck wenig Neigung, sich der Sache anzunehmen. Als auch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth, sich für nicht zuständig erklärte, konnte man ahnen, dass die Erwartungen der Verleger abermals enttäuscht werden würden. Selbst Kanzler Scholz wollte inzwischen nichts mehr von seinem Versprechen wissen, „den Lokaljournalismus und besonders die Lokalzeitungen zu schützen“, sprach vielmehr von der Notwendigkeit, „nach den Krisenjahren zur fiskalpolitischen Normalität“ zurückzufinden.
Nach der Klatsche durch die Karlsruher Richter fehlen 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt und die Regierung zieht die Notbremse. Man sei der Schaufensterreden der Regierung Scholz über den Wert der freien Tagespresse für die Demokratie leid, schäumte BDZV-Vorstandschef Stefan Hilscher, Reden, die „beim ersten Realitäts-Check zu maximal unverbindlichen Phrasen umgedichtet werden“.
Einzelne BDZV-Mitglieder haben aus der langjährigen Hängepartie um die Presseförderung inzwischen Konsequenzen gezogen. Verlage wie Madsack und Funke stellen nach und nach gedruckte Lokalaus-gaben einzelner Blätter zugunsten von rein digitalen Angeboten ein. Die Botschaft: Selbst in strukturschwachen Regionen sind Lokalzeitungen überlebensfähig – ganz ohne Zustellförderung.