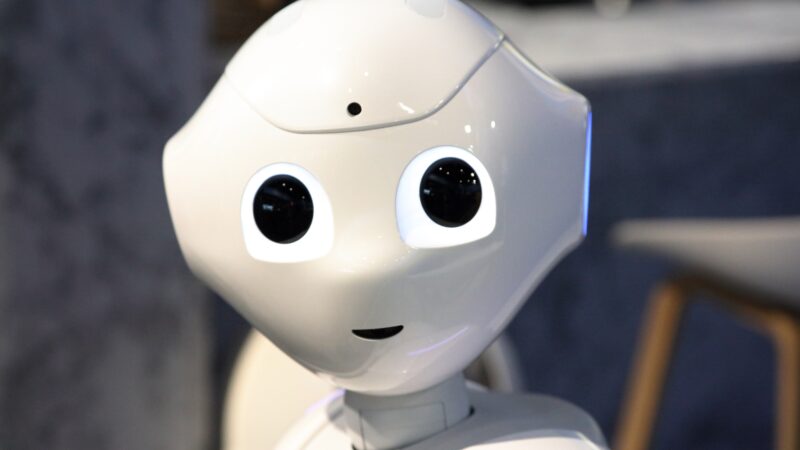Die ARD hat ihren Umgang mit Anbietern von KI geändert. Seit Ende Mai dürfen Unternehmen wie etwa Open AI, Perplexity oder Google (Gemini) Inhalte aus den Online-Angeboten der ARD nicht mehr nutzen, um damit ihre KI-Systeme zu trainieren. Das bestätigte der Senderverbund auf Nachfrage. Die ARD hat nun in ihre Webseiten einen sogenannten maschinenlesbaren Nutzungsvorbehalt technisch eingebaut. Damit wird KI-Crawlern signalisiert, dass sie die Inhalte dieser Angebote nicht verwenden dürfen.
Die ARD will jetzt mit den KI-Anbietern Gespräche führen. Ziel sei es, sich auf Regelungen zu verständigen, die „als Voraussetzung für die Nutzung der öffentlich-rechtlichen Inhalte in KI-Assistenten angesehen werden“. Dabei gehe es beispielsweise um „Mechanismen, die falsche und missverständliche Informationen verhindern“. Außerdem noch um die sachlich unveränderte Wiedergabe der Inhalte und einer Absenderkennung.
Zu diesen Punkten will letztlich auch das ZDF mit den KI-Anbietern zu Vereinbarungen kommen. Doch dem Schritt der ARD, die eigenen Inhalte nicht mehr für KI-Trainingszwecke freizugeben, folgte das ZDF bisher nicht. Dort setzt man zunächst auf Gespräche mit den Unternehmen: „Das ZDF evaluiert diese Position fortlaufend. Zu laufenden Gesprächen mit KI-Anbietern äußern wir uns nicht“, heißt es auf Anfrage.
Die Entscheidung der ARD, ihre Position zu den KI-Anbietern zu ändern, kommt etwas überraschend. Noch im Herbst 2024 hatte der damalige ARD-Vorsitzende Kai Gniffke, Intendant des Südwestrundfunks (SWR), das bisherige Vorgehen etwa mit dem Informationsauftrag der Anstalten begründet. „Mit Blick auf den Auftrag und die Finanzierung durch die Allgemeinheit ist es aus Sicht der ARD gerade im Zeitalter von Fake News und Hate Speech wichtig, dass auch die öffentlich-rechtlichen Inhalte zu den Trainingsdaten gehören“, erklärte Gniffke damals gegenüber dem Branchenmagazin „Journalist“.
Nutzungsvorbehalt als wichtiges Signal
Dass die ARD nun einen Nutzungsvorbehalt mit Blick auf KI-Anbieter eingeführt hat, sei „ein wichtiges Signal, um berechtigte Ansprüche geltend zu machen“, sagt Bettina Hesse, die bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) für Medienpolitik verantwortlich ist. Bisher hätten die Angebote zum KI-Training ausgelesen werden können, was zwar die Qualität der KI-Tools erhöht habe. Doch eine Gegenleistung habe es dafür nicht gegeben – weder für die Anstalten noch für die Urheber*innen. Dass die Anstalten einen Nutzungsvorbehalt aussprächen, sei „Voraussetzung dafür, dass auch Urheber*innen ihre Rechte wahrnehmen und die Nutzung ihrer Werke angemessen vergütet werden kann“. Das ZDF sollte sich dem Vorgehen der ARD anschließen, erklärte Hesse.
Sie verweist ferner auf „ein Dilemma des Nutzungsvorbehalts“, was mit der Marktmacht der KI-Anbieter zu tun habe: „Wer für seine Webseite einen Nutzungsvorbehalt formuliert, läuft Gefahr damit auch deren Auffindbarkeit zu torpedieren.“ Das bedeutet aber auch: Ein Nutzungsvorbehalt gilt nur für die eigenen Portale. Erfasst werden nicht zusätzlich die Inhalte, die die ARD über Plattformen von beispielsweise Meta oder Google verbreitet. Die Betreiber solcher Plattformen sind wiederum teilweise auch selbst KI-Anbieter.
Gegenüber Meta hat die ARD dem Vernehmen nach bis zum Stichtag am 26. Mai der KI-Nutzung ihrer Inhalte auf Instagram und Facebook widersprochen. Für Bettina Hesse muss im Grundsatz die Nutzung von Inhalten auf allen Ausspielwegen urheberrechtlich geschützt werden: „Dass KI-Anbieter diese bisherige Praxis einfach unterlaufen, ist das Grundproblem, das die Politik adressieren muss.“
Hesse sieht noch eine weitergehende Problematik: Inzwischen lieferten die marktdominierenden KIs wie Gemini und ChatGPT so plausibel klingende Ergebnisse, „dass Nutzer*innen kaum noch die Originalquellen der ausgegebenen Informationen aufsuchen“. Die Folge sei, dass redaktionelle Medien „von erheblichen Einbrüchen ihrer Webseitenbesuche“ berichteten. So würden „Urheber*innen und Anbieter von Journalismus um die Vergütung ihrer Leistung und um ihre wichtigen Werbeeinnahmen gebracht“.
Auffindbarkeit gewährleisten
Die Frage der künftigen Auffindbarkeit von ARD-Inhalten bei KI-Assistenten treibt auch Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), um. So seien Regeln zu etablieren, „mit denen wir die Integrität unserer öffentlich-rechtlichen Inhalte schützen und gleichzeitig eine gute Auffindbarkeit unserer Angebote gewährleisten“, sagte Wildermuth in der Mai-Sitzung des BR-Rundfunkrats.
Ähnlich sieht es Florian Hager, ARD-Vorsitzender und Intendant des Hessischen Rundfunks (HR). Durch KI werde es eine „radikale Veränderung der Mediennutzung“ geben, hatte Hager bereits Anfang April auf den Medientagen Mitteldeutschland erklärt. Man gehe in eine „Zeit von Antwortmaschinen“: Dann werde es immer mehr um das Fragenstellen gehen als ums Suchen. „Wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Produkte und am Ende unsere Inhalte, unsere Daten dafür aufzubereiten, dann findet man da einfach gar nicht mehr statt“, sagte Hager.