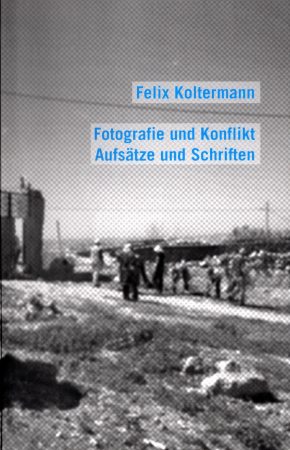Die Vielschichtigkeit von Fotografie und deren Wahrnehmung behandelt Felix Koltermann in seiner Reihe „Fotografie und Konflikt“ in ebenso klugen wie lesbaren Essays und Vorträgen. Im letzten Band der Reihe werden nochmals die Rollen von Fotojournalist*innen und der anderen Akteure wie Medien und Betrachter thematisiert: Die „zivile Aneignung“ von Bildern jenseits von Propaganda brauche „Dekonstruktion des Bildmediums“, das Erkennen der Vielschichtigkeit des fotografischen Bildes, das ja nur ein kleiner, visueller Ausschnitt vergangener sozialer Interaktion sei.
Neu ist die Diskussion um die Rolle des fotografischen Bildes zu Kriegen und gewalttätigen Konflikten wahrlich nicht. Seit Bestehen der Fotografie wird diese einerseits als „eingefrorene Realität“ und damit als Dokumentation wahrgenommen, andererseits von Anbeginn manipuliert und manipulativ benutzt.
Wie Felix Koltermann schreibt, werden Bilder als „Waffe“ gesehen, ihnen wird (kriegsentscheidende) Wirkmächtigkeit unterstellt. Die Herrschaft über die Bilder bringe die Herrschaft über die Köpfe. Embedded würden Fotograf*innen als Freund empfunden, auf gegnerischer Seite zu feindlichen Akteuren, die wie bewaffnete Kämpfer zu behandeln seien – eben Bilderkrieger, die im Zweifelsfall unter Beschuss genommen werden können.
Wie Bilder gedeutet werden, hängt Koltermann zufolge in erster Linie von den veröffentlichenden Medien ab: Sie geben das Narrativ vor. Wirtschaftliche Interessen, kulturelle wie geschichtliche und ideologische Hintergründe stellten den Zusammenhang her, wer „gut“ und wer „böse“ ist. Mag die Kameraarbeit noch so neutral gewesen sein – soweit dies überhaupt möglich ist – der Kontext des veröffentlichten Bildes bestimme maßgeblich die Bedeutung.
Im Buch wird dargestellt, wie von Bildredaktionen und in der Öffentlichkeit die Zumutbarkeit von Bildern diskutiert wird: dass nicht die Bilder das Gräuel, das Verbrechen seien, sondern die abgebildeten Taten und Situationen lenke (mitunter gewollt) von der politischen Verantwortlichkeit, der tatsächlichen Konfliktursache ab.
Mit dem Begriff Fotografie als soziale Praxis hinterfragt der Autor die Eigenverantwortlichkeit der Bildschaffenden. Die Rolle von Fotograf*innen als „Berichterstatter“ definiere sich heute in diversen Verhaltensregeln und Selbstverpflichtungen. Vorgaben durch Presseagenturen und Fotografenvereinigungen betonten Unparteilichkeit, Neutralität. Wo arbeite ich, für wen arbeite ich, wie interagiere ich mit dem Subjekt meiner Bilder – diese Fragen müssten sich Fotograf*innen immer wieder neu und oft spontan in der jeweiligen Situation beantworten bis hin zur Frage: „Bleibe ich Augenzeuge oder helfe ich?“
Felix Koltermann wertet nicht, sondern stellt zur Diskussion. Mediale Kompetenz heißt, Bilder lesen, in Kontext setzen und bewerten können. Die Reihe „Fotografie und Konflikt“ trägt viel dazu bei.
Wie kein zweiter ist der Autor, den viele aus der „Bildkritik“ der MMM kennen, geeignet, die diversen Facetten von „Fotografie und Konflikt“ zu analysieren und zu beschreiben. Der Fotodesigner, Konfliktforscher und promovierter Kommunikationswissenschaftler arbeitet heute als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Hannover und ist als freier Journalist und Referent in der Erwachsenenbildung tätig.
Felix Koltermann / Fotografie und Konflikt Band V, Eigenverlag, ISBN: 9783752602357; Bezug über Books on Demand oder die Website fotografieundkonflikt.blogspot.com