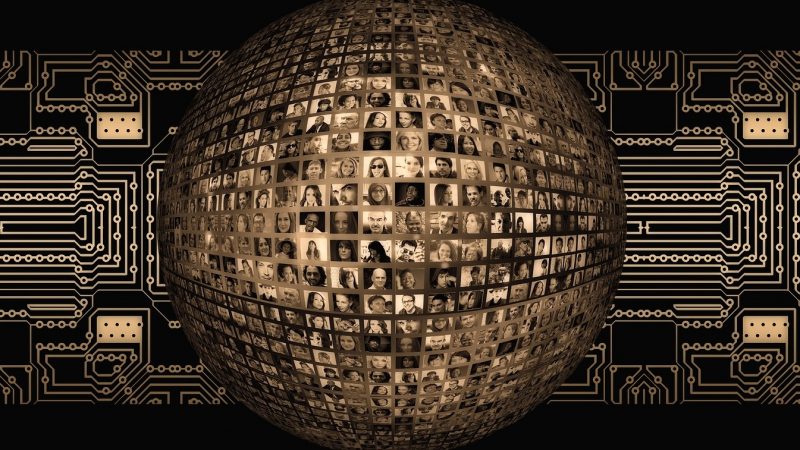Wer trägt die Verantwortung, um etwas gegen zunehmenden Hass in den sozialen Medien zu unternehmen? Die Plattformen? Die Politik? Die Nutzer*innen? Alle drei Gruppen jeweils zu einem Drittel. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie der Technischen Universität München (TUM) und der University of Oxford. Sie zeigt auch: der Großteil der Menschen in den zehn untersuchten Ländern wünscht sich mehr Moderation bei Inhalten.
Etwa 13.500 Menschen aus zehn Ländern wurden im Rahmen der Studie nach ihren Einstellungen zur Moderation und Meinungsfreiheit in den sozialen Medien befragt. Zu den Ländern zählen neben Deutschland fünf weitere europäische Staaten sowie Australien, Brasilien, Südafrika und interessanterweise die USA. Dort sitzen die meisten der Global Player im Bereich der sozialen Medien.
Gerade Facebook und X haben in den vergangenen Wochen und Monaten aufhorchen lassen, weil sie auf ihren Plattformen externe Faktenchecks nahezu abgeschafft haben. Die Plattform-Betreiber Mark Zuckerberg und Elon Musk begründen diesen Schritt damit, dass sich die Nutzer*innen mehr Meinungsfreiheit wünschen würden. Zwei Milliardäre als Vorkämpfer für die Wünsche der Menschen, die sich auf ihren Plattformen tummeln? Die Studie der TUM und der University of Oxford kommt da zu anderen Ergebnissen.
Klarer Wunsch: Mehr Moderation
Unter allen Befragten wünschen sich 79 Prozent, Aufrufe zur Gewalt in den sozialen Medien zu löschen. In den USA haben weniger Menschen diesen Wunsch, mit 63 Prozent allerdings mehr als die Hälfte der Befragten. Deutschland liegt bei diesem Punkt mit 86 Prozent zusammen mit Brasilien und der Slowakei an der Spitze. Nichts also mit uneingeschränkter Meinungsfreiheit, sondern ein ganz klarer Wunsch, mehr für die Sicherheit und gegen digitale Gewalt sowie Irreführung zu tun.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die öffentliche Meinung zur Inhaltsmoderation weitaus differenzierter ist, als die Plattformbetreiber oft annehmen oder kommunizieren, wie zuletzt Meta-Chef Mark Zuckerberg über Facebook und Instagram oder Elon Musk über X“, kommentiert Studienautorin Friederike Quint vom Lehrstuhl für Digital Governance der TUM.
Wer von den beteiligten Akteuren allerdings in die Verantwortung genommen werden soll, darüber gehen die Meinungen der Befragten auseinander. Es herrscht Einigkeit in der Uneinigkeit: Durchschnittlich sehen 35 Prozent die Plattform-Betreiber*innen, 31 Prozent die Nutzer*innen und 30 Prozent die Politik in der Pflicht. Wobei sich dieses Ergebnis auch so deuten lässt: Im Grunde müssen alle Beteiligten ihren Teil dazu beitragen, um etwas gegen Hass und Hetze in den sozialen Medien zu tun. Niemand kann sich aus der Verantwortung stehlen.
Die Macht der Masse
„Plattformen, die sich auf minimales Handeln verlassen, verlieren oft an Engagement und Rentabilität“, betont Friederike Quint und meint damit sicherlich das Beispiel X, nachdem sich unter der Führung von Elon Musk zügelloser Hass und rechte Parolen auf der Plattform breitgemacht haben. In der Folge haben viele Menschen, Organisationen und auch große Werbekunden X den Rücken gekehrt.
Genau da, nämlich beim Geld, sind Plattformen möglicherweise verwundbar. „Wenn Nutzerinnen und Nutzer weglaufen und Werbeeinnahmen massiv einbrechen, wie bei X zu beobachten, geraten auch große Plattformen in Schwierigkeiten“, ergänzt Merja Mahrt, Kommunikationswissenschaftlerin am Weizenbaum-Institut in Berlin, die zur Nutzung digitaler Medien forscht.
Kürzlich erst haben sich mehr als 75 Organisationen, darunter ver.di, Brot für die Welt, Germanwatch, Institut für Kirche und Gesellschaft – evangelische Kirche Westfalen, Wikimedia Deutschland, per offenem Brief an die Politik gewandt. Unter dem Motto „Demokratie schützen, Gemeinwohl fördern“ appellieren sie an eine künftige Bundesregierung, digitale Plattformen wirksamer zu kontrollieren.
DSA als schlagkräftiges Instrument
Die Politik ist bemüht. Innerhalb der EU – anders als in den USA – gibt es den Digital Services Act (DSA). Der DSA soll Plattformbetreiber stärker in die Verantwortung nehmen und für mehr Transparenz sorgen. „Welche konkreten Auswirkungen dieses Gesetz und seine Umsetzung auf die Social-Media-Plattformen in Zukunft haben werden, bleibt abzuwarten“, sagt Friederike Quint. „Allerdings erhalten wir bereits jetzt durch die DSA-Transparenzdatenbank deutlich mehr Einblicke in die Moderation von Inhalten auf den Plattformen.“
Auch Merja Mahrt hält die Regelungen im DSA für ein schlagkräftiges Instrument, um die Macht der großen Plattformen von politischer Seite einzudämmen. „Ich habe Hoffnungen in den DSA. Die Regelungen darin werden allerdings nicht alle Probleme auf einmal lösen.“ Denn wie die Studie der TUM zeige, trage jeder Mensch, der sich in den sozialen Medien bewegt, ebenso eine Verantwortung – sowohl für sich selbst und als auch für die Art und Weise, wie Menschen dort miteinander umgehen.
Dezentrale Plattformen: Eine Alternative?
Die Ergebnisse der TUM-Studie deuten auf einen gefährlichen Trend hin: Menschen gewöhnen sich an den rauen Ton in den sozialen Medien. Daraus erwächst ein gesellschaftliches Problem, wenn Hass und Gewalt im digitalen Austausch immer normaler werden. Deswegen fordern Netz-Enthusiasten: Weg von den großen Plattformen und rein in alternative Netzwerke mit dezentraler Struktur. Mastodon und Bluesky gehören derzeit zu den Lieblingen in der alternativen Social-Media-Szene.
„Der Wechsel auf so eine alternative, dezentrale Plattform kann ein Weg sein“, meint Merja Mahrt vom Weizenbaum-Institut. „Allerdings frage ich mich, wer die Kosten tragen soll, wenn so ein System wächst, um irgendwann ein Gegengewicht zu bestehenden Plattformen aufzubauen.“ Server müssen gehostet werden, und auch alternative Kanäle benötigen mit zunehmender Größe Betreuung und Moderation.
Sich nicht an den Hass gewöhnen
Alternative Social-Media-Plattformen bilden höchstens einen von vielen kleinen Bausteinen, um digitale Räume zu erschaffen, in denen sich Menschen künftig wertschätzend begegnen. „Diese Netzwerke haben gezeigt, dass dort zivilisiertere Diskussionen stattfinden können, aber stellen natürlich keine alleinige Lösung dar, denn kein soziales Netzwerk ist völlig frei von Missbrauch“, betont Studienautorin Friederike Quint von der TUM.
Ein Auftrag lässt sich aus den Studienergebnissen ableiten: Es braucht eine gesellschaftliche Debatte über gemeinsame Normen und Werte in der digitalen Welt. Diese sollte zwingend über Ländergrenzen hinweg geführt werden. Damit sich Menschen nicht an Hass in den sozialen Medien gewöhnen müssen.