Nach vierjähriger AfD-Präsenz im Bundestag hat sich die Hoffnung, die Partei werde sich entzaubern, als frommer Wunsch erwiesen. Die „Alternative für Deutschland“ hat im Gegenteil gelernt, ihre Instrumente noch effektiver einzusetzen und missbraucht das Parlament regelmäßig als Bühne, um Bilder für Auftritte bei Facebook und YouTube zu produzieren. In seinem Buch „Propaganda 4.0“ beschreibt Johannes Hillje, wie die AfD die digitalen Medien konsequenter als jede andere Partei benutzt, um ihre Klientel zu erreichen und noch enger an sich zu binden.
Kommunikationsberater Hillje spricht von einem „Informationskrieg“. Die Strategie der Partei ziele darauf ab, das Sagbare im öffentlichen Diskurs zu verändern und mittels eines eigenen Medienapparats „eine digital konstruierte, radikal rechte ‚Desinformationsgesellschaft’“ als Kontrast zu den von der AfD als „Systemmedien“ und „Lügenpresse“ bezeichneten etablierten Medien zu schaffen. Alice Weidel, Spitzenkandidatin der Partei für die bevorstehende Bundestagswahl, hat diese Vorgehensweise vor drei Jahren mit dem griffigen Slogan „AfD statt ARD“ umrissen.
Bei der Präsentation der aktualisierten Neuausgabe seines 2017 erschienenen Buches am 10. August machte Hillje deutlich, welche Erfolge die Partei mit ihrer Digitalstrategie in den vergangenen vier Jahren erzielt habe. Dass heute mehr Menschen als noch vor gut zehn Jahren den klassischen Medien misstrauten, führt der Politikwissenschaftler auch auf die Öffentlichkeitsarbeit der AfD zurück. Deren Politik sei zudem nicht ohne Wirkung auf andere Parteien geblieben, wie sich an der Haltung der CDU in Sachsen-Anhalt zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags gezeigt habe.
Als Basis für den Erfolg der Partei betrachtet Hillje den Aufbau eines eigenen Medienapparates und dessen Verknüpfung mit den rechten Netzwerken. In einem internen Papier („Strategie 2019-2025: Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei“) sind die Ziele unter der Überschrift „Der Kampf um die Meinungs- und Deutungshoheit“ klar formuliert. Die politische Agenda der Rechtsextremisten mag rückwärtsgewandt sein, aber digital sei die Partei allen anderen voraus, wie nicht zuletzt die Verwendung einschlägiger englischer Fachbegriffe verdeutlicht („Framing, Priming, Virtue Signalling, Nudge, Negative oder Dirty Campaigning, Astroturfing“). Viele dieser Instrumente sind bekannt und haben auch frühere Wahlkämpfe geprägt. Framing zum Beispiel ist die Einbettung von Ereignissen in einen bestimmten Deutungszusammenhang, Negative und Dirty Campaigning erklären sich von selbst, und sogar die Ursprünge des Astroturfings sind ein alter Hut, denn sie liegen in der Graswurzelbewegung.
Das knappe Gut Aufmerksamkeit gekapert
Zum „Novum in der Kommunikationskultur der deutschen Parteienlandschaft“ werde das Vorgehen der AfD laut Hillje durch die Konzertierung der verschiedenen Maßnahmen. Astroturfing zum Beispiel soll eine Graswurzelbewegung bloß simulieren, also eine Massenbewegung vortäuschen, wo gar keine existiert. Er erläutert dies in seinem Buch anhand eines Gedankenspiels. Zum Feindbild im aktuellen Wahlkampf habe die AfD die Grünen erkoren, weshalb sich die Rechten zu Bewahrern des Lebensstils ihrer Anhängerschaft („Diesel, Schnitzel, Billigflug“) erklärt hätten. Im Zusammenhang mit der Dieseldebatte beschreibt Hillje ein Szenario, bei dem zahlreiche vermeintlich spontane „Gelbwesten“-Proteste orchestriert würden: „Derartige Bilder, massenhaft verbreitet über die reichweitenstarken Digitalkanäle der Partei, könnten wie ein Brandbeschleuniger in der öffentlichen Debatte über Klimapolitik wirken.“.
Im Rahmen der Buchvorstellung schilderte die frühere Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Renate Künast, wie die AfD das Parlament mit demagogischen Mitteln für ihre Zwecke instrumentalisiere: „Jeder Tag beginnt mit einem Tabubruch.“ Die entsprechenden Auftritte der Rechten landeten anschließend nicht nur in deren digitalen Kanälen, auch die etablierten Medien „stürzen sich darauf“. Dank dieser Strategie, ergänzte Hillje, erreiche die Partei regelmäßig ihre Kernklientel, weshalb sich ihre Umfragewerte „trotz politischer Nicht-Leistungen“ konstant im zweistelligen Bereich bewegten. Die „relevante Reichweite“ gerade des Youtube-Auftritts zeige sich nicht zuletzt in den 30 Millionen Aufrufen während der zurückliegenden Legislaturperiode. Die AfD habe sich auf diese Weise „ein eigenes Massenmedium“ für ein „digitales Volk“ mit gemeinsamer Identität geschaffen.
Die Zukunft der Demokratie wird im Netz entschieden
Wie viele andere rechtspopulistische Bewegungen, so Hillje in seinem Buch, sei auch die AfD ein „Spitzenverdiener der Aufmerksamkeitsökonomie“: Diesen Bewegungen gelinge es „mitunter völlig überproportional zu ihrer politisch-institutionellen Bedeutung, das knappe Gut der Aufmerksamkeit in der medial und digital vermittelten Öffentlichkeit an sich zu reißen.“ Auch in dieser Hinsicht nutzt die Partei also eine Strategie, die in Folge der 68er-Bewegung entstanden ist: die Etablierung einer Gegenöffentlichkeit. Künast befürchtet angesichts der zunehmenden Bedeutung der digitalen Medien ein „massives Demokratieproblem“. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedrohung von Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagierten. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister legten angesichts von Hass und Hetze im Netz ihre Ämter nieder: „Die Zukunft der Demokratie wird im Netz entschieden.“
Immerhin attestiert Hillje den etablierten Parteien einen Lernprozess: 2015 und 2016 habe es einen „sehr rechtsextrem geprägten Diskurs über Geflüchtete“ gegeben. Mittlerweile sei allen klar geworden, dass die AfD „über die Veränderung der Sprache die Wirklichkeit verändern“ wolle. Andererseits gelinge es der Partei nach wie vor, den parlamentarischen wie auch den gesellschaftlichen Diskurs zu zerstören, indem sie die Debatten extrem polarisiere. Infolgedessen würden die unterschiedlichen Lager nicht mehr in der Sache argumentieren, sondern sich nur noch gegenseitig delegitimieren. Die AfD, schreibt Hillje in seinem Buch, habe aber „nicht nur das Sagbare verändert, sondern auch längst auch das Machbare“. Die sprachliche Gewalt habe ihr Echo „in physischer Gewalt auf den Straßen gefunden“: „in Kassel, in Halle, in Hanau.“
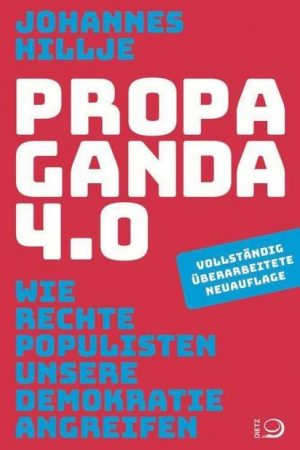 Johannes Hillje: Propaganda 4.0. Wie rechte Populisten unsere Demokratie angreifen. Vollständig überarbeitete Neuauflage. Dietz-Verlag 2021, 192 Seiten, 18 Euro, ISBN: 978-3-8012-0623-9
Johannes Hillje: Propaganda 4.0. Wie rechte Populisten unsere Demokratie angreifen. Vollständig überarbeitete Neuauflage. Dietz-Verlag 2021, 192 Seiten, 18 Euro, ISBN: 978-3-8012-0623-9



