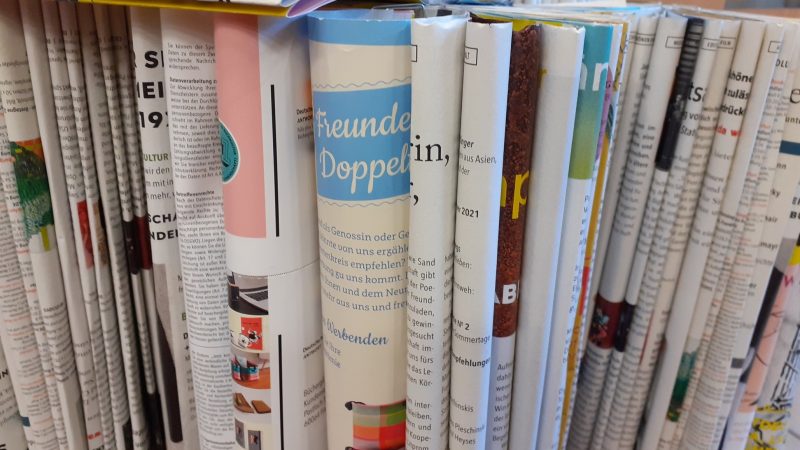In der Frage einer staatlichen Pressehilfe bahnt sich möglicherweise ein neuer Konflikt in der Ampel-Regierung an. Ein vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) beauftragtes Gutachten sieht eine Zustellförderung für bestimmte Printmedien als wirtschaftlich sinnvoll und verfassungskonform an. Dennoch verweist das BMWK gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf fehlende Zuständigkeit für eine potenzielle Presseförderung.
Die Branche drängt dagegen auf eine schnelle Umsetzung der Gutachter-Voten. „Eindeutiger kann eine Handlungsempfehlung an die Bundesregierung nicht formuliert werden“, erklärte Sigrun Albert, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV). Mit den konkreten Vorschlägen des Gutachtens sei eine Regelung „noch vor der Sommerpause“ möglich. Die Verleger klagen seit geraumer Zeit über die massiven Kostensteigerungen in Produktion und Vertrieb. Zu den gestiegenen Energie- und Kraftstoffkosen und den erhöhten Papierpreisen trifft sie seit Oktober 2022 auch noch die durch Anhebung des Mindestlohns deutlich gestiegenen Vertriebskosten.
Nach der vom BDZV beauftragten Schickler-Studie „Trends der Zeitungsbranche 2023“ hatten 63 Prozent der an der Umfrage beteiligten Verlage mit dem Gedanken gespielt, die Zeitungszustellung in unwirtschaftlichen Bereichen einzustellen. Keine leere Drohung, wie eine kürzlich bekannt gewordene Entscheidung der Funke Medien Thüringen belegt. Zum 1. Mai 2023 beendet die Gruppe mangels ausreichender Rentabilität die Zustellung der „Ostthüringer Zeitung“ in den meisten Gemeinden des Landkreises Greiz. Ab dann werden die Abonnements nach erfolgter Registrierung auf digital umgestellt.
Erst vor einem halben Jahr hatte sich Bundesfinanzminister Christian Lindner auf dem Jahreskongress des BDZV zu dem Versprechen der Ampel-Regierung bekannt, „die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen zu gewährleisten“. Das federführende Wirtschaftsministerium, so Lindner seinerzeit, prüfe gegenwärtig noch, „welche Förderinstrumente geeignet sind, um den Aussagen des Koalitionsvertrags nachzukommen“.
Zusätzlichen Druck auf die Bundesregierung hatte der Bundesrat in seiner Sitzung am 16. September aufgebaut. In einer Entschließung forderte er die Ampel auf, „zeitnah ein Förderkonzept vorzulegen, dass eine unabhängige journalistische Tätigkeit der Medienhäuser auch zukünftig gewährleistet“. Denn, so die Begründung des Rates, „gerade in Zeiten von Fake News, Desinformation, Deepfakes und Verschwörungstheorien brauche es weiterhin eine leistungsfähige Medienlandschaft“.
Auch ver.di sieht Gefahren für die Meinungsvielfalt infolge steigender Pressekonzentration. Direkte staatliche Fördermittel, so Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz damals, seien aber ein „hochsensibles Unterfangen“, für das klare Maßgaben gelten müssten. ver.di fordert, den Bezug von Förderung an bestimmt Konditionen zu knüpfen, „insbesondere Tarifbindung in den Betrieben, die Einhaltung des Pressekodex und einen hohen redaktionellen Anteil“ in den geförderten Medien.
Das am 31. März veröffentlichte Gutachten der WIK-Consult aus Bad Honnef schlägt nach ausführlicher wirtschaftlicher Analyse der Branche vor allem eine Zustellförderung speziell für die Printausgaben regionaler Abo-Tageszeitungen vor. Für überregionale Tages- und Wochenzeitungen sowie für kostenlose Anzeigenblätter bedürfe es „weiterer Erwägungen“. Für das Segment der Zeitschriften können die Gutachter „aufgrund der Heterogenität keine eindeutige Indikation für eine Zustellförderung ableiten“.
Die Beispielrechnungen der „möglichen jährlichen Fördersummen“, basierend auf geschätzten Steigerungen der Durchschnittskosten und einem angenommenen Auflagenrückgang von fünf Prozent jährlich, haben es in sich. Die vorgeschlagenen Förderbeträge nur für Tageszeitungen würden 2023 etwa 144 Millionen Euro betragen und in den beiden Folgejahren auf 206 bzw. 261 Millionen Euro ansteigen.
Zum Vergleich: Im letzten Jahr der Großen Koalition, hatte der damalige Finanzminister Olaf Scholz den Verlagen 220 Millionen Euro spendieren wollen – erst als Vertriebsförderung, später umdeklariert als Mittel zur Unterstützung der „digitalen Transformation“. Nach einer Klagedrohung digitaler Startups wegen mutmaßlicher Verletzung der Pressefreiheit durch Verzerrung des Wettbewerbs war das Projekt im April 2021 stillschweigend von der Agenda gestrichen worden.
Auch in der Ampel-Regierung scheint sich die Lust auf eine Entscheidung in Grenzen zu halten. Das Wirtschaftsressort verweist laut dpa darauf, man mache sich die Schlussfolgerungen der Studie nicht zu Eigen und plane keine weiteren Schritte. Aus dem Haus von Staatsministerin Claudia Roth, der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, heißt es lapidar, die Zuständigkeit für eine mögliche Förderung werde derzeit innerhalb der Bundesregierung geklärt.
BDZV-Hauptgeschäftsführerin Sigrun Albert drängt darauf, „dass Bundeskanzler Scholz nun sehr schnell über die Zuständigkeit für das Thema in der Bundesregierung entscheidet und dann umgehend die Weichen für die Förderung gestellt werden“. Denn: „Jeder Tag, den wir verlieren, gefährdet die Pressevielfalt und am Ende unsere demokratische Gesellschaft.“