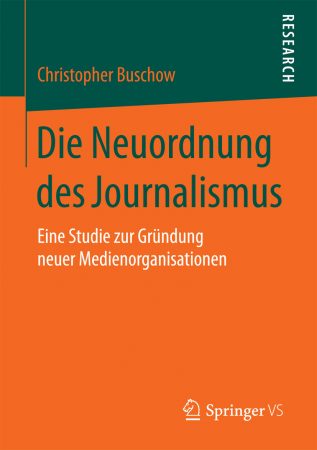„Hohe gesellschaftliche Relevanz des Themas“ und „ernüchternde Ergebnisse“ – der Hannoveraner Kommunikationswissenschaftler Christopher Buschow hat bereits viel Resonanz bekommen für sein Buch. Er untersuchte am Beispiel von 15 Medien-Neugründungen in Deutschland, wie Journalismus in Zukunft aussehen könnte.
Bei der umfangreichen Studie handelt es sich um Buschows 2016 vorgelegte Dissertation, die in diesem Jahr mit dem Deutschen Studienpreis ausgezeichnet wurde. In der ersten Hälfte des Bandes entwickelt der Autor einen neuen praxistheoretischen Rahmen für Journalismus- und Medienmangementforschung, der als Vergleichsfolie für seine empirische Untersuchung dient.
Vor allem die Ergebnisse dieser Fallstudie sind für die journalistische Praxis interessant. Im österreichischen Standard wurden zwei Befunde rezipiert, die sich als „ernüchternd“ erwiesen: Mediengründungen schaffen kaum neue Jobs, sondern verschärfen eher die Selbstausbeutung. Außerdem findet in den Start-ups eine Vermischung von Redaktion und Verlag statt, weil Gründer_innen beide Aufgaben übernehmen.
Buschow vergleicht den industriellen Produktionsmodus etablierter Medien mit dem vernetzten von Medienneugründungen, die zwischen 2011 und 2014 entstanden. Er konstatiert, dass die Start-ups zumeist die alten Redaktionspraktiken und Normen (Pressekodex) beibehalten – sei es aus Marketinggründen oder wegen einer Kooperation mit etablierten Medien. Allerdings gebe es Innovationen bei den Darstellungsformen. Zudem würden Nutzer_innen stärker integriert, etwa bei Themenfindung und Recherche. Teilhabe erweise sich hier als „marktgängiges Produkt“.
Reichweitenmäßig bleiben die Start-ups, die nicht tagesaktuell informieren, aber Nischenanbieter. Verglichen mit Presseverlagen sind sie kleiner, flexibler, kostengünstiger. Die Gründer_innen charakterisiert Buschow als „sozialunternehmerische ‚Missionare’“, die vor allem „größere journalistische Freiräume“ und „alternative Organisationsarrangements“ schaffen wollen. Gegründet wird zumeist im Team, das sich aus Journalismus und Verlagswirtschaft rekrutiert, vereinzelt aus Technologie sowie Kunst und Kultur. Quereinsteigende seien durch die geringen Gewinnversprechen abgeschreckt.
Die Neugründungen praktizierten zum Teil neue Formen einer vernetzten Zusammenarbeit – mit freien Autor_innen oder mit Rezipierenden, die eine “Entbetrieblichung“ der redaktionellen Arbeit kennzeichnet. Durch die neue Produktionsweise entstehen Wertschöpfungsnetzwerke – etwa in Form von Rechercheverbünden, die für die öffentliche Kommunikation eine wichtige Rolle einnehmen könnten, so der Autor. Medienpolitik solle unterstützend eingreifen, etwa durch steuerliche Anreize für Medieninvestoren, die „nachhaltige, qualitätsvolle Produktion von Journalismus“ garantieren. Öffentlich-rechtliche Rundfunkbeiträge könnten für eine Startfinanzierung verwendet werden und Ausbildungsstätten sollten angehende Journalist_innen auch auf Managementtätigkeiten vorbereiten. Außerdem gelte es, die Vernetzung von Neugründungen zu fördern, um Ressourcen zu bündeln, Aktive zu professionalisieren und Interessen fokussiert zu vertreten.
Zahlreiche Zitate veranschaulichen die Ergebnisse der gut lesbaren Studie. Doch durch die – forschungsethisch überzeugend begründete – Anonymisierung der 15 Start-ups, bietet sich eher ein Puzzle mit Lücken, bleiben Zusammenhänge unklar: Hängt Selbstausbeutung mit der Finanzierungsart oder der Organisationsform zusammen? Wissenschaftler_innen mag das zu Folgeuntersuchungen motivieren, Journalist_innen zu weiteren Recherchen. Das Buch enthält nicht nur für Medienpolitiker_innen wichtige Impulse für den gesellschaftlichen Diskurs über die Zukunft des Journalismus.
Christopher Buschow: Die Neuordnung des Journalismus. Eine Studie zur Gründung neuer Medienorganisationen. Springer VS, Wiesbaden 2018. 447 Seiten. 59,99 Euro. ISBN: 978-3-658-18871-9 (Print) 978-3-658-18872-6 (Online)