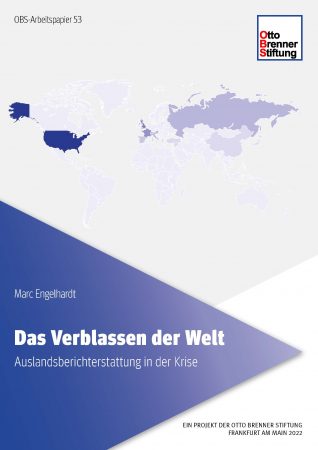„Es wirkt paradox“, hieß es vor ziemlich genau drei Jahren in einem M-Online-Dossier: „In einer Zeit, in der die Menschheit zusammenrückt, in der die Globalisierung zunimmt, nehmen auch die weißen Flecken in der Auslandsberichterstattung deutscher Verlage zu.“ Eine Entwicklung, die sich laut einer aktuellen Studie der Otto Brenner Stiftung seither eher verschärft hat. Das „Verblassen der Welt“ belegt Marc Engelhardt anhand einer Presse-Langzeitausweiterung.
Weite Teile der Welt, so die Analyse des langjährigen Korrespondenten Marc Engelhardt, sind in der deutschen Auslandsberichterstattung extrem unterrepräsentiert. Dazu zählen nicht nur arme Länder wie Moldawien oder Krisenregionen wie die umkämpfte Westsahara und die Länder der Sahel-Zone. Als die Taliban nach 20 Jahren Besatzung Afghanistan zurückeroberten, war die deutsche Öffentlichkeit konsterniert: Offensichtlich hatte die Berichterstattung – fixiert vor allem auf Kabul und die Bundeswehr-Standorte – die tatsächliche Lage im Land völlig falsch eingeschätzt. Ein ähnliches Szenario droht sich in Mali zu wiederholen.
Das „Verblassen der Welt“ belegt der Autor anhand einer Langzeitausweiterung von 23 überregionalen und regionalen Zeitungen in Deutschland. Im Ranking der Berichterstattung liegen Länder wie die USA, Großbritannien, Frankreich und andere europäische Nachbarn weit vorn. Mit Israel, China, Japan und Syrien schaffen es gerade mal vier außereuropäische Länder unter die Top 15. Am Ende der Skala dann 15 Länder, die von den Medien im Zeitraum von zehn Jahren komplett ignoriert wurden, darunter Äquatorialguinea, Guyana und die Republik Moldau.
Die Gründe für diese Fehlentwicklung: Spardruck in Redaktionen und schrumpfende Budgets, damit einhergehend die Abnahme der Zahl von Auslandsseiten und Sendeplätzen. Statt kontinuierlicher Berichterstattung finde diese nur noch anlassbezogen statt – unvermeidlich angesichts ausgedünnter Korrespondent*innen-Netzwerke. Das alles vor dem Hintergrund zusätzlicher Hürden für die Arbeit der Medienarbeiter*innen: Weltweit wächst die Zahl autoritärer Regime, die die Berichterstattung durch repressive Maßnahmen und verstärkt eingesetzte Propaganda erschweren.
Unter den von Engelhardt skizzierten unabdingbaren Eckpunkten für einen zukünftigen Auslandsjournalismus rangiert an erster Stelle eine Stärkung der Netzwerke und Zusammenschlüsse freier Korrespondent*innen. Als Modelle nennt er Netzwerke wie „Weltreporter“ und „Hostwriter“. Auch müsse sichergestellt werden, „dass die Auslandsflächen nicht noch weiter schrumpfen“. Gerade im öffentlichen-rechtlichen Rundfunk erwartet er ein „deutliches Eintreten der Rundfunkräte für eine breite Berichterstattung aus dem Ausland“. Von der Politik fordert er ein stärkeres Engagement bei Verstößen gegen die Pressefreiheit, etwa wenn Journalist*innen im Ausland bedroht werden. Außerdem plädiert er für eine – gegenwärtig politisch nicht gewollte – öffentliche Förderung der Auslandsberichterstattung. Diese müsse die Unabhängigkeit der Berichterstattung gewährleisten und Korrespondent*innen vor Ort „ebenso unterstützen wie Publikationen, die mehr Raum für Auslandsberichte schaffen“.
Letzte Meldung: Nach öffentlicher Kritik an ihrer mangelnden Präsenz vor Ort will jetzt auch die ARD mehr Korrespondenten an den Kriegsschauplatz Ukraine schicken. Zuvor hatte der Sender aus Sicherheitsgründen alle eigenen Reporter abgezogen und auf Journalisten anderer Medien sowie auf Fremdvideomaterial zurückgegriffen.
Marc Engelhardt. Das Verblassen der Welt. Auslandsberichterstattung in der Krise. OBS-Arbeitspapier 53, Frankfurt/M 2022