Seit 15 Jahren befindet sich die Welt in einer Art Dauerkrise: die Banken, der Euro, die Flüchtlinge, Corona; und nun auch noch der russische Überfall auf die Ukraine. Darüber müssen Medien selbstverständlich berichten. Kein Wunder, dass das manchen Menschen zuviel wird. Ronja von Wurmb-Seibel plädiert in ihrem Buch daher für mehr Geschichten, die Mut machen.
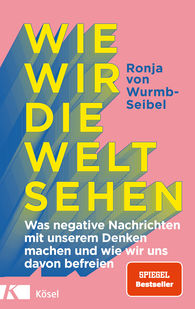
Die Autorin beginnt mit einem Bekenntnis, das für eine Journalistin eher ungewöhnlich ist: Sie liest keine Zeitungen mehr; „Tagesschau“ oder „heute“ boykottiert sie ebenso wie die politischen Talkshows. Das tun andere zwar auch, aber sie hat Politikwissenschaften studiert und früher für das Politikressort der „Zeit“ gearbeitet. Ihr Sinneswandel erfolgte, während sie 2013 und 2014 als Reporterin in Afghanistan war. Als sie feststellte, dass ihr die Auseinandersetzung mit dem Elend jegliche Lebenskraft entzog, hielt sie gezielt Ausschau nach positiven Geschichten.
Diese Haltung prägt auch ihr Buch. Darin geht sie der Frage nach, wie sehr Nachrichten unser Denken, unsere Wahrnehmung und unser Leben beeinflussen. Wir Menschen brauchten Geschichten, schreibt sie, um unsere Erlebnisse und Erinnerungen abzuspeichern. Geschichten, und dabei schließt sie Medienberichte ausdrücklich mit ein, hätten entscheidenden Einfluss darauf, „ob wir Angst vor der Zukunft haben oder uns auf sie freuen.“ Was mache es also mit uns, „wenn wir uns ohne Unterlass mit Katastrophen, Gewalt und Zerstörung konfrontieren?“
Die Wirkungsforschung hat sich in unzähligen Studien damit beschäftigt, welchen Einfluss filmische Gewaltdarstellungen haben. Die Wirkung von Nachrichten ist längst nicht so intensiv erforscht worden, die Ergebnisse sind zudem widersprüchlich. Einige Studien sagen: Wer dauernd Berichterstattungen etwa über Terrorismus wahrnimmt, leidet irgendwann unter den gleichen Folgen wie Menschen, die Terror tatsächlich erlebt haben. Deshalb ist die Journalistin überzeugt: Der dauerhafte Konsum negativer Nachrichten führe fast zwangsläufig zu Angst, aber auch zu Schuldgefühlen, „weil wir nicht noch mehr tun, um die Welt zu verbessern“; schließlich erwecke die Berichterstattung den Eindruck, dass die Missstände unabänderlich seien. Dieser generelle „Negativ-Filter“, behauptet Wurmb-Seibel, sei vielen Menschen längst in Fleisch und Blut übergegangen. Sie plädiert daher für eine nur auf den ersten Blick naiv klingende Alternative: Die Kolleginnen und Kollegen in den Medien sollten ihre Blicke verstärkt auf das Positive richten. Ihre drastisch formulierte Formel für konstruktiven Journalismus lautet „Scheiße plus X“: den Missstand weder verschweigen noch verharmlosen, aber stets auch Auswege aufzeigen; und mehr Geschichten über Menschen erzählen, die die Welt ein Stückchen besser gemacht hätten. Außerdem sollten Berichte nicht immer nur dem vom Mythos der Heldenreise geprägten Narrativ des heroischen Individuums folgen, denn der Fokus auf eine zentrale Figur klammere das gemeinschaftliche Handeln aus. Zu guter Letzt wendet sie sich mit einem Appell an ihre Leserschaft: im Gespräch mit Nachbarn, Freunden und Verwandten nicht immer nur jammern und klagen, sondern auch und vor allem über die schönen Dinge des Lebens sprechen! Tatsächlich leben wir ja allen Krisen zum Trotz statistisch in der besten aller Welten, was Hunger, Verbrechen und Bildung angeht; zumindest im Vergleich zur bisherigen Menschheitsgeschichte.
Ronja von Wurmb-Seibel: „Wie wir die Welt sehen. Was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien“. Kösel-Verlag, München. 238 Seiten, 18 Euro.


