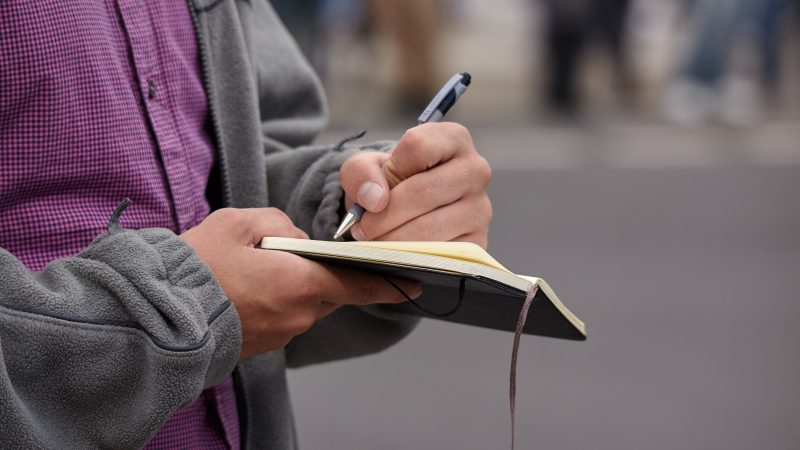Medien können eine schützende Rolle dabei spielen, rechtsextremen Tendenzen entgegenzuwirken und die Demokratie zu stärken. Handlungsempfehlungen dafür haben Pia Lamberty und Maheba Goedeke Tort im CeMAS-Policy-Brief „Über Rechtsextreme reden? Empfehlungen für die mediale Berichterstattung“ zusammengestellt. Das geschieht vor dem Hintergrund, dass sich auf der einen Seite rechtsextreme Parteien radikalisieren. Gleichzeitig finde eine gesellschaftliche Normalisierung rechtsextremer Positionen und Erzählungen statt.
Die beiden Autorinnen empfehlen zwölf Ansätze für den medialen Umgang mit Rechtsextremismus. So müssten rechtsextreme Ideologien und Milieus klar benannt werden. Zu vielen rechtsextremen Gruppierungen gebe es ausreichend Fachexpertise.
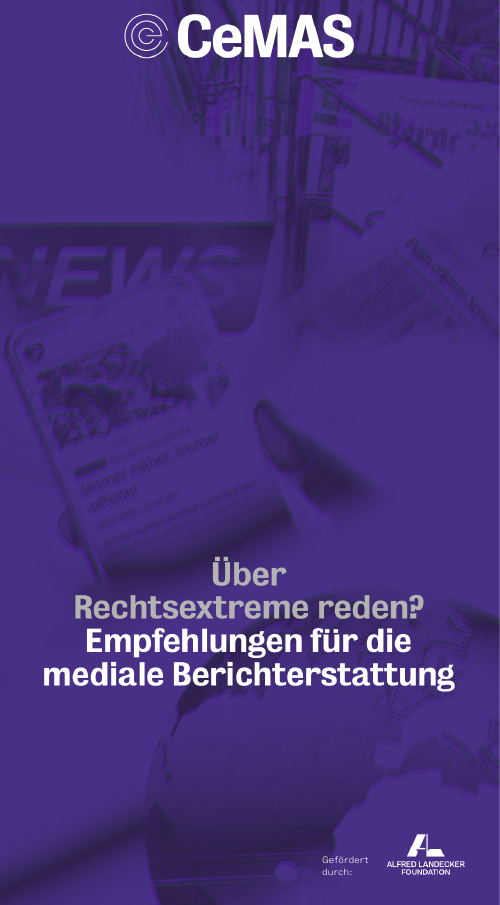 Wiederholt wird Rechtsextremen eine Plattform geboten, die sie dann auch gezielt für sich nutzten. Rechtsextreme schafften es dadurch immer wieder, eigene Themen auf die mediale Agenda zu setzen, die in der Folge breit diskutiert würden.
Wiederholt wird Rechtsextremen eine Plattform geboten, die sie dann auch gezielt für sich nutzten. Rechtsextreme schafften es dadurch immer wieder, eigene Themen auf die mediale Agenda zu setzen, die in der Folge breit diskutiert würden.
Trotz der Berichterstattung über zentrale Personen dürfte ihnen und ihren Positionen kleine Bühne geboten werden. Zugleich warnen die Autorinnen davor, Zitate von Rechtsextremen in Überschriften zu verwenden. Viele Leser*innen und Nutzer*innen läsen nur diese. Zumal wenn der dekonstruierende Text dann hinter der Paywall stecke.
Redaktionelle Leitlinien gefordert
Die Autorinnen empfehlen zugleich klare und transparente Leitlinien etwa im Umgang mit der AfD. Das helfe, einer Opferinszenierung entgegenzuwirken. Mit einem sogenannten Fakten-Sandwich sollten Journalist*innen auf Falschaussagen reagieren. Diese dürften nie unwidersprochen bleiben.
Journalist*innen sollten sich nicht nur auf Polizeimeldungen als Quelle bei Protesten stützen, so heißt es in den Empfehlungen von CeMAS, dem Center für Monitoring, Analyse und Strategie, weiter. Außerdem sollten sie sich in ihrer Berichterstattung nicht nur auf die Rechtsextremen fokussieren, sondern die Betroffenen im Blick behalten.
Kontinuierliche Berichterstattung angemahnt
Zugleich warnen Pia Lamberty und Maheba Goedeke Tort davor, Anhänger*innen von Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien als „verrückt“, „dumm“ oder „irre“ abzutun. Und sie plädieren für eine kontinuierliche und einordnende Berichterstattung. Denn Rechtsextremismus komme nicht aus dem Nichts.
Schließlich fordern die Autorinnen von den Medienhäusern, ihre Mitarbeiter*innen gut vorzubereiten und bestmöglich zu schützen. Und sie mahnen: „Jedes Mal, wenn der Rechtsextremismus erstarkt, ähneln oder wiederholen sich die Debatten und Lernprozesse, wie medial damit umgegangen werden sollte.“ Nur selten würden die Erkenntnisse festgehalten und die Arbeit daran verstetigt. „Prozesse der Evaluation helfen dabei, eine bessere Berichterstattung über Rechtsextremismus zu erlangen – und nicht heute noch Bilder von Männern mit Glatze und Springerstiefeln als Symbolbild für Rechtsextremismus zu nutzen.“