Achtsamkeit und feinsinnige Bewusstheit nach „innen“ und nach „außen“ bezeichnete der Journalistikprofessor Claus Eurich bereits 2011 als „Schlüsselkoordinaten“ kommunikativer Kompetenz. Mittlerweile gilt Achtsamkeit als Megatrend, der alle Lebensbereiche erreicht. Die Coachin und Dozentin für kreatives und literarisches Schreiben Sandra Miriam Schneider hat nun mit „Achtsames Schreiben. Wie Sie Klarheit und Gelassenheit gewinnen“ einen ersten deutschsprachigen Ratgeber vorgelegt, der in die Praxis des achtsamen Schreibens einführt.
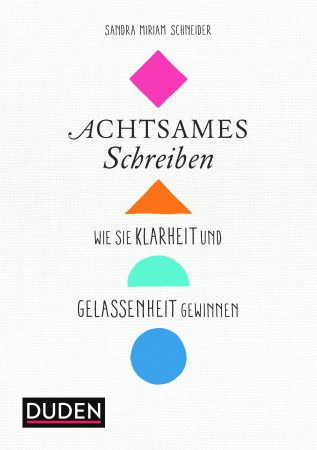
Bei Achtsamkeit gehe es „um Verbundenheit mit der Welt, mit anderen Menschen und mit uns selbst und mit dem gegenwärtigen Augenblick, der all das enthält“, beschreibt Schneider die Grundhaltung, die achtsamem Schreiben zugrunde liege. Diese will sie den Leser_innen vermitteln, um ihnen zu mehr Klarheit und Gelassenheit beim Schreiben zu verhelfen – sei es um Schreibblockaden aufzubrechen, den eigenen Stil zu finden oder mit Zeitdruck und störendem Perfektionismus fertig zu werden.
Schneider arbeitet nicht nur als selbstständige Coachin und Dozentin, sondern ist auch Gründerin der „Literaturschneiderei“ in Berlin. Sie hat Schreibexperimente entwickelt, indem sie Elemente des kreativen, meditativen und autobiografischen Schreibens mit Aspekten des klassischen Zen-Buddhismus und zeitgenössischen Varianten wie Mindfulness-Based Stress Reduction MBSR nach Jon Kabat-Zinn kombinierte. Die Experimente im Buch, die sechs Kapiteln zugeordnet sind, ermöglichen interessierten Leser_innen, ihre eigene Schreibpraxis zu reflektieren, indem sie ein „Achtsamkeitsjournal“ führen. Darin sollen sie Erfahrungen, Erkenntnisse und Fragen notieren.
Die Übungen vertiefen die Sachinhalte, sodass sie als passgenaue persönliche Ratschläge gelesen werden können, etwa, wenn es darum geht, den „richtigen Ort“ fürs Schreiben zu finden: Arbeitszimmer, Garten, Tisch im Kaffeehaus oder das Bett, in dem z. B. Astrid Lindgren ganze Vormittage verbrachte und somit „zur Spezies der horizontalen Autorinnen und Autoren gehört“. Eine der Übungen zu diesem Kapitel über bestmögliche Voraussetzungen fürs Schreiben heißt “Raumstation“. Die Leser_innen werden aufgefordert, die Atmosphäre eines jeden Raums ihrer Wohnung bewusst wahrzunehmen und festzuhalten, wie diese ihr Schreiben beeinflusst hat. Genauso wie der Ort spielen auch die Tageszeit – morgens oder nachts –und die Technik des Schreibens – per Hand oder mit Computer – eine wichtige Rolle.
Schneider erläutert fünf Fähigkeiten und Haltungen, die wichtig für achtsames Schreiben sind. Dabei geht es vor allem um literarische Genres, aber vieles gilt auch für journalistische Formate. So etwa ihre erste Anforderung an achtsames Schreiben, nämlich „gegenwärtig“ zu sein, d.h. die eigenen Gedanken so zu lenken, dass sie immer wieder zum Schreiben zurückkehren. Unter „Aufmerksamkeit ohne Urteil“ versteht Schneider, den fertigen Text nicht sofort zu bewerten, sondern zunächst so zu akzeptieren wie er ist und ihn erst nach einer Weile noch einmal aus kritischer Distanz reflektierend durchzulesen.
Letzteres ist mit „Nicht-Identifikation“ während des Schreibprozesses gemeint. Literat_innen ermuntert sie auf der Inhaltsebene zur „Nicht-Identifikation“ mit dem erzählenden Ich, denn nur so könnten Figuren bewusst nach fiktionalen Weltentwürfen gestaltet werden. Diese Freiheit biete beispielsweise das autobiografische Genre der Autofiktion. Wichtig sei außerdem der „Anfänger(innen)geist“, d. h. „die Dinge so zu betrachten, als ob wir sie zum ersten Mal sehen, mit vorurteilsfreiem Blick“. Unter „Selbstmitgefühl“ versteht Schneider schließlich Verständnis dafür zu haben, „wie und was wir geschrieben oder eben auch nicht geschrieben haben“ und den „Kampf um vermeintliche Schreibperfektion aufzugeben“.
Zur „Schreibpersönlichkeit“ werde man durch das Bewusstmachen eigener Werte und Motivationen, durch das Trainieren aller Sinne, um die Umwelt genauer wahrnehmen und in Worte fassen zu können. So „tragen Beschreibungen von Düften wesentlich dazu bei, dass Texte sinnlicher werden.“ Durch Spielen mit verschiedenen Stilen von sachlich-nüchtern bis fantasievoll-fabulierend gelte es, die eigene „Muttersprache“, den persönlichen Stil zu finden.
Unser Schreibfluss sei geprägt durch das individuelle Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele, so Schneider. Sport sei für viele Autor_innen als Ausgleich zur „Kopflastigkeit“ des Schreibens zum hilfreichen „Ritual“ geworden. Martin Walser schwimme z. B. so „oft wie möglich in seinem geliebten Bodensee“. Auch Atemübungen und Schreibpausen könnten mehr Gelassenheit angesichts eines „weißes Blatts“ befördern. Wenn der Schreibfluss auf Widerstände stößt, rät Schneider zur Entschleunigung – um den „Widerstand als „Ausgangspunkt für Wandel“ zu nehmen. Dabei helfe Disziplin, den Weg zu gehen, den „wir selbst gewählt“ haben. Schneider: “Ob es für Sie stimmig ist, bei einer gefühlten Schreibblockade aufzuhören oder weiterzuschreiben, können nur Sie selbst entscheiden.“ Dabei berge das „Nicht-Perfektsein und die Erlaubnis zum Scheitern oft mehr Potential … als das sture Streben nach Perfektion“.
Zitate und Beispiele illustrieren Schneiders Texte genauso wie die farbigen Seiten und Ornamente, die Kapitel und Abschnitte gliedern. Die kunstvolle, verspielte Gestaltung des Bandes dominiert vor klarer Strukturierung. So sind Anmerkungen und Zitatnachweise am Ende leider keinen konkreten Textstellen zugeordnet. Die Auffindbarkeit bestimmter Inhalte erleichtern aber ein Sach- und Personenregister im Anhang. Außerdem gibt es ein Literaturverzeichnis. Der Ratgeber richtet sich vor allem an Autor_innen, die professionell oder hobbymäßig an literarischen Texten arbeiten, aber auch für Journalist_innen dürfte er inspirierend sein.
Sandra Miriam Schneider: Achtsames Schreiben. Wie Sie Klarheit und Gelassenheit gewinnen. Dudenverlag Berlin 2018. 156 Seiten.15,00 € . ISBN: 978-3-411-70557-3


