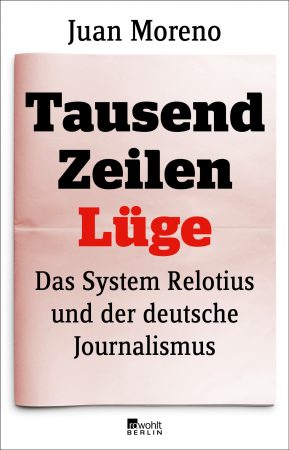Er hat für den bisher größten Fälschungsskandal im deutschen Journalismus gesorgt: Claas Relotius. Der freie Journalist Juan Moreno war der Mann, der dieses Lügengebäude zum Einsturz brachte – und dabei seine eigene Existenz riskierte. In seinem Buch „Tausend Zeilen Lüge“ schreibt er diese Geschichte auf. Es ist eine Geschichte, die so unglaublich ist wie sie klingt. Fesselnd wie ein Krimi, verstörend wie es nur eine wahre Begebenheit sein kann.
Über viele Jahre hat Claas Relotius, der zuletzt zum Leiter des Spiegel-Gesellschaftsressorts berufen werden sollte, scheinbar unbemerkt Dutzende journalistische Texte gefälscht, mehr als 50 davon allein während seiner Tätigkeit für den Spiegel. Etwa 40 Preise hat der 33jährige dafür bekommen, nicht wenige Male stand er kurz davor, aufzufliegen. Moreno beschreibt ihn als einen Solokletterer, einen „gelassenen Todgeweihten“.
Der Autor war als Freier zu einem großen Teil selbst für den Spiegel tätig, verfasste zusammen mit Relotius den Text „Jaegers Grenze“, der den Stein schließlich ins Rollen brachte. Auf den knapp 300 Seiten seines bei Rowohlt erschienen Buches schildert er auf packende Weise die Ereignisse, die von seinen ersten Zweifeln bis zum Geständnis Relotius‘ gegenüber der damaligen stellvertretenden Gesellschaftsressortleiterin Özlem Gezer führten.
Doch nicht nur. Moreno begibt sich auch auf eine Spurensuche auf Claas Relotius‘ Lebensweg, spricht mit allen Personen, die bereit sind, mit ihm zu sprechen – zu denen allerdings weder Relotius selbst noch seine Eltern gehören. Dabei erfährt er beispielsweise, wie der Student Claas Relotius schon seinen Kommiliton*innen an der Hamburg Media School Lügen auftischte. Wie etwa die, er hätte während seines Pflichtpraktikums bei der Deutschen Welle Trainerlegende Hans Mayer interviewt. Oder die, er hätte nach einer Autofahrt mit verbundenen Augen einen mexikanischen Drogenboss getroffen und interviewt.
Fassungslos bleibt dabei zurück, wer sieht, wie viele Hinweise es gab, wie oft das „System Relotius“, wie Moreno es nennt, kurz vor dem Zusammenbruch stand. Doch gehörte es eben auch zu diesem System, sich aus solch kritischen Situationen immer wieder herauswinden zu können. Stets fand Relotius, der „Menschenfänger“, einen Ausweg, zum Beispiel indem er E-Mails von vermeintlichen Quellen fälschte. Oder er hatte sein Umfeld bereits so sehr geblendet, dass man ihm uneingeschränkt vertraute. Zum Beispiel als die damaligen beiden Leiter des Gesellschaftsressorts Ullrich Fichtner und Matthias Geyer Relotius zum Spiegel holten, kurz nachdem dieser als „CNN-Journalist of the Year“ ausgezeichnet worden war. „Hätten Matthias Geyer oder Ullrich Fichtner kurz im Internet den Namen ‚Claas Relotius‘ gegoogelt“, schreibt Moreno, „hätten sie bemerkt, dass er ein paar Monate zuvor ein Problem mit ‚NZZ Folio‘ gehabt hatte“. Die Schweizer hätten die Zusammenarbeit mit ihm wegen Unsauberkeiten in seinen Texten beendet, so Moreno.
Moreno versteht sein Buch dabei aber nicht als Abrechnung – und dieses Versprechen löst er ein. Mit der Rolle seiner Vorgesetzten im Spiegel, Ullrich Fichtner, Matthias Geyer und Özlem Gezer, setzt er sich kritisch, doch zugleich fair und sachlich auseinander. Ebenso mit der Aufarbeitung der Causa Relotius durch den Spiegel, die im Mai mit dem – zum Teil auch von Moreno kritisierten – Abschlussbericht der eigens eingesetzten Aufklärungskommission ihr vorläufiges Ende fand.
Eine Kollektivschuld des Journalismus oder eine besondere Anfälligkeit des Genres Reportage erkennt Moreno nicht, spricht deshalb auch explizit vom „System Relotius“ als alleinigem Verantwortlichen. Auch anfängliche Erklärungsversuche Relotius‘, er habe zu sehr unter Druck gestanden, nimmt ihm der Autor des Buches nicht ab. Für ihn ist der Spiegel-Reporter ein Hochstapler wie er im Buche steht. Krank? Vielleicht. Ändern würde das nichts.
Bei alledem klingt Moreno niemals pathetisch, noch beleidigt. Es gelingt ihm trotz der direkten Betroffenheit eine größtmögliche Objektivität. Eine absolute Leseempfehlung, auch für Nicht-Journalist*innen!