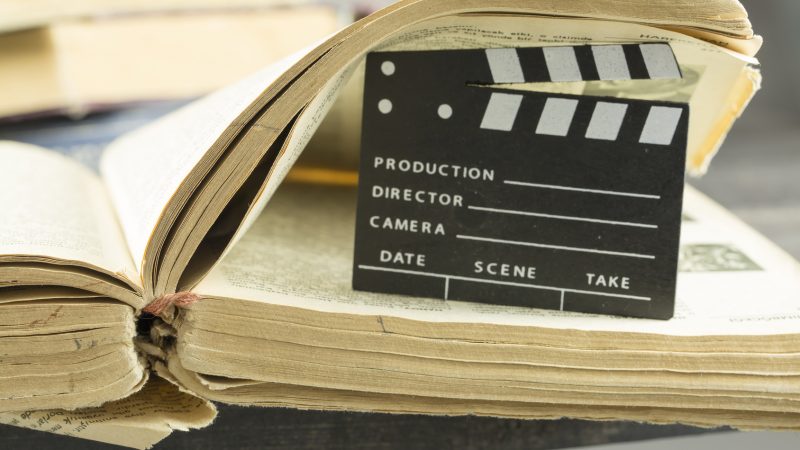Vor wachsendem gesellschaftlichem und politischem Rechtsextremismus warnt das Netzwerk Film und Demokratie. Denn die Neue Rechte hat Kultur längst als Kampffeld entdeckt. Unter dem Motto Demokratie unter Druck – die Filmbranche in der Verantwortung, kam das Bündnis am vergangenen Dienstag zusammen. Gemeinsam mit der Filmemacherin Agnieszka Holland und dem Soziologen Matthias Quent wurde diskutiert, wie Filmschaffende gemeinsam auf rechte Tendenzen im Kulturbetrieb reagieren können.
Auch in Deutschland versuchen rechtsextreme Gruppierungen und Akteur*innen durch offene und verdeckte Attacken, ihren Einfluss auf die Film- und Medienpolitik auszuweiten. Nicht zuletzt streuen sie Zweifel an der gesellschaftlichen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der Filmförderung und der Kunst. Das Netzwerk Film und Demokratie ist ein Bündnis von Einzelpersonen, der Gewerkschaft ver.di, Verbänden und Organisationen der Film- und Medienbranche, der Film- und Medienbildung und der Medienkultur, die sich gegen die rechtsextreme und rechtspopulistische Einflussnahme auf Medienschaffende, Medieninhalte und Medienkultur stellen.
Kulturkampf in Polen
Die polnische Filmemacherin Agnieszka Holland beschrieb bei der Veranstaltung des Netzwerks die Situation für Filmemacher*innen in Polen. Mehrfach hat die rechtskonservative Regierung seit ihrer Amtsübernahme bereits unliebsame Führungskräfte aus staatlichen Kulturinstitutionen gedrängt oder versucht, Ausstellungen und Aufführungen zu verhindern. Denn für rechte Parteien ist Kunst und Kultur ein Teil ihrer nationalistischen Identitätspolitik. Beispiele dafür gibt es in Ungarn, Italien, aber auch hierzulande. Eine grundsätzliche Neuausrichtung der Kulturpolitik mit dem Ziel der „Verteidigung der deutschen Identität“ verlangte kürzlich die AfD-Fraktion im Bundestag.
Die traditionsreiche polnische Filmbranche ist besonders von der nationalistischen Politik der Regierung in Warschau betroffen. In vielen Fällen würden kritische Produktionen als „anti-polnisch“ gebrandmarkt, berichtete Holland. Sie sieht allerdings weniger eine direkte Zensur, als vielmehr einen stillen Druck auf die Künstler*innen. Der sei vor allem finanzieller Natur. Bestimmte Themen könnten nicht mehr behandelt werden, wenn Filmemacher*innen eine staatliche Förderung für ihre Produktionen wollten. Das führe zu einer starken Konformisierung der Filmszene. Den Verzicht auf kontroverse Stoffe betrachtet Holland als Selbstzensur. Ein vorauseilender Gehorsam, den die Filmemacherin allerdings nicht nur in Polen beobachtet. Die Mutlosigkeit und den Eskapismus, den Holland dem europäischen Film bescheinigt, sei ein Grund für die hohen Publikumsverluste. Der europäische Film sei insgesamt mutlos, bürgerlich und mittelmäßig. „Alle haben Angst vor einer Provokation“, fasst sie zusammen.
Wie die AfD Druck macht
Vor allem den Konformitätsdruck kann auch der Soziologe Matthias Quent bestätigen. Er ist Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und begleitet das Netzwerk mit seiner wissenschaftlichen Expertise. Quent betrachtet die von Holland beschriebene Mutlosigkeit als politische Gefahr. Denn dieser Druck funktioniere auch ohne (Regierungs-)Macht. Er wirke so stark, weil es eine Tendenz zur Bequemlichkeit gebe. Auf parteipolitischer Ebene sei das deutlich zu erkennen. Im Erfurter Landtag und im Bautzener Kreistag stimmen AfD und CDU gemeinsam ab. In vielen Klein- und Mittelstädten im Süden und Osten habe sich die AfD enttabuisiert, die einstige Brandmauer nach rechts stehe nicht mehr. Aber auch gesellschaftliche Diskurse wie die gendergerechte Sprache, der Klimawandel oder Verschwörungserzählungen seien Einfallstore für rechte Ideologie.
„Es reicht nicht, sich gut zu fühlen“
Für die Filmbranche wünscht sich Quent, dass weniger leere Felder hinterlassen würden, die dann von rechts besetzt werden können. Er fordert eine „positive Gegenerzählung“ zur rechten Endzeitrhetorik. Damit meine er Alternativen zum Status quo, Utopien und Provokationen. Selbstverständlich müsse die Branche aber auch nach innen blicken und eigen Strukturen kritisch hinterfragen. „Es reicht nicht, sich gut zu fühlen“, sagte Quent. Denn die eigene Etikettierung als links und fortschrittlich könne auch ein Teil des Problems der Filmbranche sein.