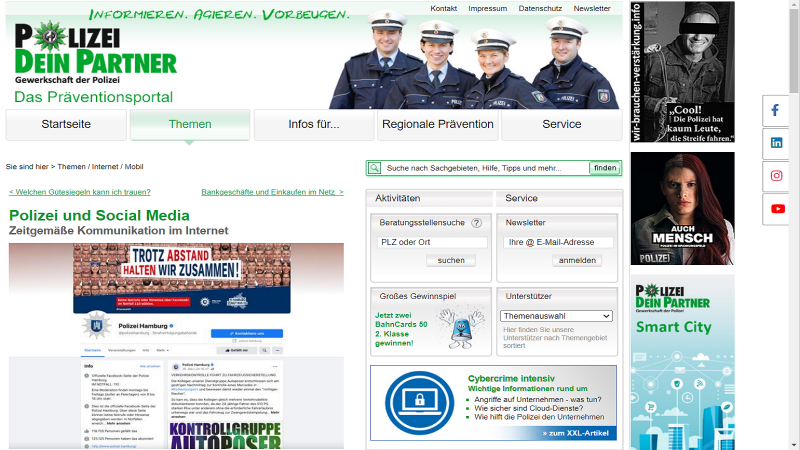In Zeiten von Echtzeitkommunikation bedient auch die Polizei zahlreiche Social-Media-Accounts. Ob diese für Medienschaffende als Quelle taugen, ist umstritten. Viele Journalist*innen übernehmen dennoch, was die Polizei im Netz postet und twittert. Dabei ist nach zahlreichen Vorfällen klar: Die Polizei ist ein eigenständiger Akteur in der öffentlichen Meinungsbildung. Der Medienwissenschaftler Michael Graßl von der Universität Eichstätt hat die Kommunikation der Polizei in den sozialen Medien untersucht. Mit M spach er über kanalspezifische Unterschiede, Fehlerkultur und corporate Influencer.
M | Was genau haben Sie sich für ihre Studie angesehen?

Foto: privat
Michael Graßl | Ich habe zwölf längere Leitfadeninterviews mit Social-Media-Verantwortlichen bei der Polizei in ganz Deutschland geführt. Das sind mehrheitlich ausgebildete Polizeibeamte, die sich dann intern -weiterbilden. Außerdem habe ich mir über 1000 Social-Media Posts der Polizei auf Facebook, Twitter und Instagram genauer angesehen.
Gibt es kanalspezifische Unterschiede in der Kommunikation?
Für die einzelnen Kanäle gibt es in der Tat unterschiedliche Strategien. Facebook ist ein Allrounder, wo verschiedene Themen und Ansprachen vorkommen, Twitter ist stärker auf rasche Informationen ausgelegt und Instagram ist der Schönling unter den Kanälen. Da wird schon mal ein Sonnenuntergang gepostet. Es wird mehr mit Humor gearbeitet, der Kanal ist meinungsstärker und die Community wird direkter angesprochen. Auch Nachwuchswerbung findet dort verstärkt statt.
Auf einigen Kanälen tritt die Polizei nicht als namenlose Institution auf, sondern mit Influencern in Uniform. Ist das Teil der Kommunikationsstrategie?
Häufig ist das ein Corporate-Influencer-Modell, wie das üblich ist in sozialen Medien. Man greift sich ein Gesicht heraus, das dann den Kanal repräsentieren soll. Mit privaten Accounts sollen Polizisten aus Sicht der Behörden eher nicht in die Öffentlichkeit gehen, denn da fehlt ihnen dann die Kontrolle über den Content. Vor allem soll aber mit der Uniform auf Social-Media kein Geld verdient werden.
In einem Kapitel ihres Buches haben Sie sich das Verhältnis zwischen Presse und Polizei angesehen. Hat sich daran durch Social Media etwas verändert?
Es hat sich verändert und verändert sich weiter. Oft bekommen Journalist*innen über Twitter schneller ihre Informationen, als wenn sie die Pressestelle anrufen würden. Das sind neue Gewohnheiten. Aber gerade in ländlichen Regionen, wo sich Pressevertreter*innen und Polizei noch wirklich kennen, wird das Verhältnis auch unpersönlicher.
Als Quelle oder gar als privilegierte Quelle sind Polizeiangaben schon immer umstritten. In den sozialen Medien unterlaufen der Polizei schnell mal inhaltliche Fehler, die dann von der Presse zum Teil übernommen werden. Wird das als Problem wahrgenommen?
In den Interviews war dieses Problembewusstsein nicht wirklich vorhanden. Aber die Expert*innen bei der Polizei lernen dazu und entwickeln eine Praxis, wo sie möglichst auch unter Zeitdruck erst dann Informationen veröffentlichen, wenn sie auch wirklich gesichert sind. Intern werden solche Fehler dann zwar besprochen, aber die Aufarbeitung dauert oft lange und ist nach Außen auch wenig transparent.
Es kommt vor, dass die Polizei Journalist*innen an der Berichterstattung, oft im Zusammenhang mit Demonstrationen oder Protesten, behindert, dann aber selbst darüber twittert.
Das ist in Bezug auf die Pressefreiheit bedenklich. Presse und Polizei müssen sich im Idealfall ergänzen und nicht behindern. Das gilt auf Social Media ebenso wie auf der Straße.
Wenn die Polizei als medialer Akteur auftritt, muss es doch auch Regeln für die Kommunikation geben. Bei Journalist*innen regelt das die Meinungs- und die Pressefreiheit.
Da gibt es bislang nur vage gesetzliche Regelungen. Die Öffentlichkeitsarbeit soll sachlich, richtig und neutral sein. Was das konkret für die Öffentlichkeitsarbeit in Sozialen Medien bedeutet, ist aber häufig unklar. Der Bundestag hat sich im Jahr 2015 damit zwar befasst, dabei ging es aber nicht um Falschmeldungen oder Richtigstellungen.