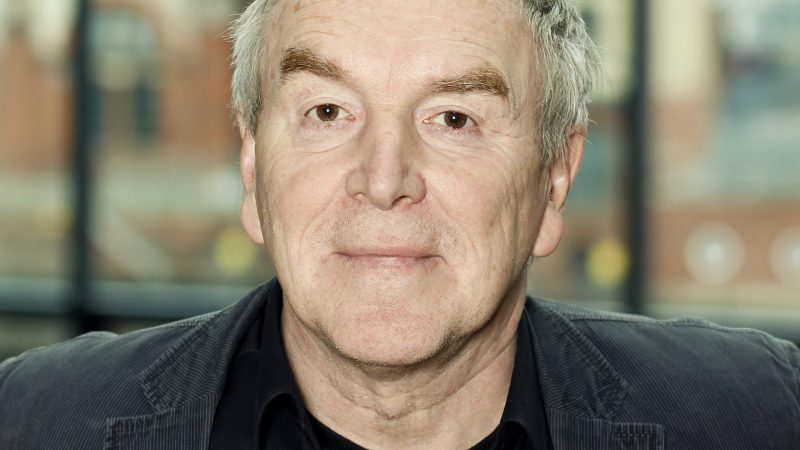Wer als Privatmensch Kenntnis erhält von schweren Straftaten, ob geplant oder bereits begangen, sollte umgehend die Polizei verständigen. Das ist geradezu staatsbürgerliche Pflicht. Anders verhält es sich, wenn ein großes Boulevardmedium den Ermittlern aktiv zuarbeitet und die Gelegenheit nutzt, in großem Stil gleichzeitig in eine reißerisch aufgezogene Verdachtsberichterstattung einzusteigen. So geschehen im Fall des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Christoph M., gegen den wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornographie ermittelt wird.
Bild, das Schmuddelkind der deutschen Publizistik, zog wie gewohnt alle Register: voller Name, unverpixeltes Foto und Video von der Hausdurchsuchung. Flankiert mit dem beiläufig eingestreuten Hinweis, dass es sich zunächst um einen Anfangsverdacht handle, mithin vorläufig das Prinzip der Unschuldsvermutung gelte.Eine verlogene Methode. „Durch die blickfangartige Aufmachung gerade im Boulevard ist die Stigmatisierung eigentlich nicht wegzukriegen“, kritisiert im NDR-Mediemagazin „Zapp“ der Berliner Anwalt Christian Schertz, spezialisiert auf Medienrecht und Persönlichkeitsrechtverletzungen. Er hält die komplette Berichterstattung über C.M. in den Medien schlicht für „rechtswidrig“. Denn auf den geifernden publizistischen Leitwolf folgte wie üblich das Rudel: die Meute derer, die nach kurzer Schamfrist der Versuchung nicht widerstehen können, auch im Interesse von Auflagen und Klicks an dieser Story zu partizipieren. Es sei eine durchaus übliche Machart des Boulevardjournalismus, sich Berichterstattungstatbestände zu schaffen, indem man selbst Ermittlungsverfahren produziere, bemerkt Schertz. Bild selbst hatte die Behörde auf den Vorgang hingewiesen. Die ursprüngliche Behauptung, der Hinweis sei von einer Freundin des Beschuldigten gekommen, entpuppte sich schnell als Lüge. Das Landgericht Köln hat dem Springer-Verlag inzwischen per einstweiliger Verfügung diese „identifizierende Berichterstattung“ im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen C.M. verboten.
Nun ist eine Verdachtsberichterstattung nicht grundsätzlich verwerflich. Aber allein die Prominenz des Beschuldigten reicht nicht aus, um dermaßen grelle sensationell aufgezogene mediale Inszenierungen abzusondern. Schließlich geht es um einen grundrechtssensiblen Bereich: die Abwägung zwischen öffentlichem Informationsinteresse und den Persönlichkeitsrechten des Betroffenen. Dass Bild im Zweifel „auf den Rechtsstaat scheißt“ (Vice), ist sattsam bekannt. Eben erst kassierten das Blatt und sein Digitalableger drei Rügen des Presserats, unter anderem wegen blutrünstiger Berichterstattung über den Stuttgarter „Schwert-Mord mitten auf der Straße“.
Wenn Bild-Chef Reichelt jetzt behauptet, man habe aus dem Fall Kachelmann in Sachen Verdachtsberichterstattung dazu gelernt, so ist das pure Heuchelei. Das Verfahren gegen den ehemaligen Wettermoderator der ARD gilt bis heute als Prototyp einer aus den Fugen geratenen Medienhetze. Dafür sorgte nicht zuletzt Bild mit seiner einseitigen, die Unschuldsvermutung mit Füßen tretenden „Prozessbeobachterin“ und Altfeministin Alice Schwarzer. Was dem Blatt nach erfolgtem Freispruch Kachelmanns hohe Schmerzensgeldforderungen eintrug. Dem Betroffenen nutzte das nichts: In eine vergleichbare berufliche Position konnte Kachelmann nie wieder zurückkehren. Unterm Strich also ein Beispiel für das Versagen des Rechtsstaats.
Falls sich am Ende die Unschuld von C.M. herausstelle, sicherte Bild schon mal treuherzig „prominente Berichterstattung“ zu, „in tatsächlich vergleichbarem Umfang“. Die Botschaft hören wir wohl, allein uns fehlt der Glaube. Und selbst wenn: Schon jetzt ist der Beschuldigte beruflich weitgehend isoliert. Was bei Leserinnen und Zuschauern hängenbleiben dürfte: Da war doch mal was mit Kinderpornographie!