Wahlerfolge der AFD, Blockade-Aktionen vor Flüchtlingsunterkünften, Pegida- und „Nein zum Heim!“-Demonstrationen in vielen Städten. Kein Zweifel, die rechte Bewegung erlebt in den letzten Monaten auch in Deutschland einen Aufschwung. Dabei ist ihr es gelungen, über ihre kleinen rechten Zirkel hinaus auch in Bevölkerungskreise einzuwirken, die sich nicht zur Rechten zählen würden. Das wird deutlich, wenn sich Menschen mit Schildern „Wir sind besorgte Bürger und keine Nazis“ an Demonstrationen beteiligen, die von extremen Rechten organisiert werden. Doch der rechte Einfluss zeigt sich nicht nur auf der Straße, sondern auch im gesellschaftlichen Diskurs.
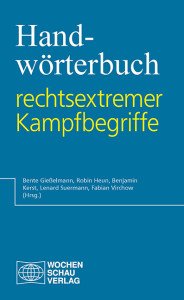
Auf die bisher zu wenig beachteten rechten Erfolge auf der Ebene der Sprache und der öffentlichen Debatte macht das „Handwörterbuch rechtsextremer Kampfbegriffe“ aufmerksam. Es ist als Kooperationsprojekt des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung (DISS) und des Forschungsschwerpunkts Rechtsextremismus/Neonazismus (FORENA) an der Hochschule Düsseldorf entstanden. Beide wissenschaftliche Institutionen forschen seit Längerem zu der Frage, wie rechte Kreise mit eigenen Kampfbegriffen die gesellschaftliche Debatte bestimmen. 20 Autor_innen stellen in informativen Aufsätzen 25 solcher Begriffe vor, die in der rechten Debattenkultur aktuell eine Rolle spielen. Dazu gehört der „68er“ ebenso wie die „Geschlechtergleichstellung“, die zu den besonderen Kampfbegriffen der Rechten gehören.
Mitherausgeber Fabian Virchow unterscheidet Typen von rechten Kampfbegriffen, die unterschiedliche Funktionen haben, deren Abgrenzung aber nicht immer möglich ist. So gibt es Begriffe, die den politischen Standort im rechten Lager markieren sollen. Als Beispiel führt Virchow “Schuldkult“ an, eine Wortschöpfung, mit dem die extreme Rechte Gedenkveranstaltungen zu NS-Verbrechen abwertet und verhöhnt. Andere originär braune NS-Sprachschöpfungen waren später in großen Teilen der Gesellschaft mit Recht tabuisiert und werden in letzter Zeit von der Rechten wieder reaktiviert. Dazu gehören Begriffe wie „deutsche Volksgemeinschaft“ oder der Verweis auf ein „Tausendjähriges deutsches Reich“. Vor einiger Zeit waren das noch Codes kleiner rechter Zirkel. In den letzten Monaten wurden sie von Rechtsaußen-Politikern der AfD wie Björn Höcke in Reden vor Tausenden Menschen verwendet. Eine dritte Gruppe von Begriffen verweist auf Politikvorstelllungen, die eigentlich nichts mit rechtem Gedankengut zu tun haben. Doch im aktuellen rechten Diskurs werden Termini wie „Freiheit“ und „Demokratie“ immer dann verwendet, wenn es darum geht, „Volkes Stimme“ gegen „abgehobene Politiker“ oder die Eliten in Stellung zu bringen. Darauf gehen Bernhard Steinke und Fabian Virchow in dem Handbuch ein. Eine weitere Begriffsgruppe, die untersucht wird, ist ebenfalls außerhalb rechter Kreise entstanden, wurde aber mittlerweile von Rechts gekapert. Dazu gehören Termini wie Political Correctness oder Islamisierung. Noch vor einem Jahrzehnt stand der Begriff „Islamisierung“ mit der Kritik säkularer Kräfte am Machtanspruch religiöser Kräfte in direktem Zusammenhang. Benjamin Kerst zeigt in seinen Aufsatz, wie der „Islamismus“ zum Kampfbegriff der Rechten wurde und durch Pegida eine regelrecht mobilisierende Wirkung bekommen hat.
Das informative Handwörterbuch richtet sich an Multiplikator_innen aus Schule, Sozialarbeit und Gewerkschaft, aber auch an Journalist_innen.


