„Aufklärerische Überzeichnung“ gegen „religiöse Überzeugung“, Vernunft gegen Glaube, Kunst gegen Kirche – kurz: herrschaftskritisches Wahrheitsstreben. Mit diesen hehren Worten lobt der Verlag sowohl auf dem Schutzkarton als auch auf einem extra beigelegten Zettel im Namen des Herausgebers die historische Entwicklung der Karikatur, wie sie Andreas Platthaus in seinem aktuellen Buch „Das geht ins Auge. Geschichten der Karikatur“ darlegt.
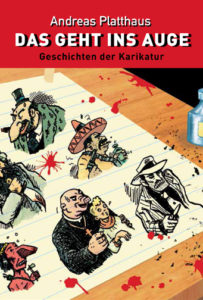
Die kenntnisreich geschriebenen 50 Episoden über Karikaturen aus 1800 Jahren widerlegen diese Werbetexte allerdings. Rote Fäden in der Geschichte der Karikatur sind eher künstlerische Traditionslinien als weltanschauliche Haltungen. Autor Platthaus ist nicht unschuldig an der irreführenden Bewerbung des Buches. Der Leiter des Literatur-Ressorts der „Frankfurter Allgemeinen“ (FAZ) schreibt schon im ersten Kapitel, dass zur Karikatur „Widerstand“ gehöre, ja sogar „das Bedürfnis nach Aufklärung im modernen Sinne und damit nach Gesellschaftskritik“. Doch schon die wohl älteste Karikatur der Welt, eine im zweiten oder dritten Jahrhundert (das Buch enthält widersprüchliche Angaben) unserer Zeitrechnung in eine Mauer Roms eingeritzte Verspottung von Christ_innen, entspricht nicht dieser Anforderung, denn das Christentum wurde damals verfolgt.
Im Folgenden nimmt uns der Comic- und Karikaturenexperte mit auf eine Zeitreise vor allem nach England, Frankreich und in deutsche Lande, mit Abstechern in die USA, nach Indien, Japan, Dänemark und, mehr noch, Italien. Wir lernen so, dass „caricare“ auf Italienisch „überladen“ bedeutet und dass zwei Brüder namens Carracci sich Ende des 16. Jahrhunderts als Erste systematisch dieses Stilmittels bei gezeichneten Porträts bedienten. Den Begriff „Caricatura“ prägte dann ein Kunsthistoriker im Jahr 1646.
Lange waren Karikaturen nur witzige Personendarstellungen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren. Im 19. Jahrhundert wurden sie politischer und somit laut Platthaus „Gradmesser der Aufklärung“. Die Messung bringt ernüchternde Ergebnisse. Im Ersten Weltkrieg betrieben alle Satireblätter „nationale Propaganda“, hält der Autor fest, selbst die über ihre Landesgrenzen hinaus berühmten „Punch“ und „Simplicissimus“. Auch die Nazis setzten viele Karikaturen ein, ein Teil davon gezeichnet von Branchengrößen. Der „Simplicissimus“ ordnete sich dem Regime unter. Aus der DDR weiß Platthaus kaum von mutigen Karikaturen zu berichten. Hannes Hegen, dem Schöpfer der Zeitschrift „Mosaik“ und der im Osten bis heute berühmten Figuren „Digedags“ attestiert er „beruflichen Opportunismus“.
Platthaus zeigt also, dass Karikaturen im Lauf der Jahrhunderte eben nicht vorwiegend herrschafts- oder religionskritisch waren. Sein Buch verfolgt, anders als die Werbung nahelegt, keinen roten Faden vor aktuellem Hintergrund (der Mordanschlag auf die französische Satirezeitung Charlie Hebdo vom 7. Januar 2015), sondern bietet ein episodisches historisches Panorama der Karikatur.
Dabei ist der zweifellos kenntnisreiche Platthaus, der auch von Besuchen bei berühmten Karikaturisten berichten kann, ausschweifend bis zur Geschwätzigkeit, was das Buch auf 480 Seiten aufbläht. Er gefällt sich zudem als kunsthistorisch Bewanderter und verwendet immer wieder unnötige französische Wörter (sowie übrigens einige für einen Zeitungsredakteur peinliche Schachtelsätze). Mit zunehmender Lektüre zunehmend ärgerlich ist, dass jedes Kapitel (bis auf eines) nur eine Abbildung enthält, der Autor aber fast immer auch ein anderes, meistens mehrere andere Bilder beschreibt. Ein Buch über Karikaturen, in dem mehr Karikaturen beschrieben als abgebildet sind, muss wohl als Sparversion eines historischen Panoramas angesehen werden.
Andreas Platthaus: „Das geht ins Auge. Geschichten der Karikatur“, Verlag Die Andere Bibliothek, 480 Seiten, Fadenheftung, 42 EUR.


