„Der israelisch-palästinensische Konflikt ist einer der weltweit am längsten schwelenden Konflikte. Er stellt ein hochkomplexes soziales System dar, in dem viele verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Motiven agieren.“ Diesen Konflikt hat Fotoreporter und Wissenschaftler Felix Koltermann untersucht. Denn, so seine Beobachtung, das „Handeln von Fotojournalisten in Konflikten stellt einen bisher wenig beachteten Teilbereich des Auslands- und Konfliktjournalismus dar.“
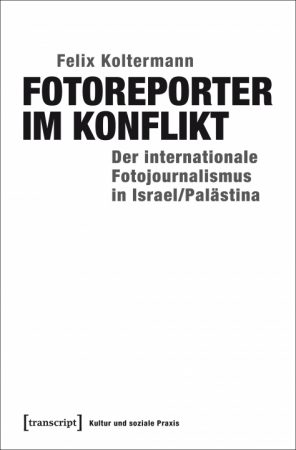
Der Forschungsgegenstand seiner mit einem ausführlichen Theorieteil startenden Dissertation ist das fotojournalistische Handeln von Fotograf_innen, die im Kontext des Nahostkonflikts für den internationalen Bildermarkt arbeiten. Insofern ist die Arbeit handlungstheoretisch ausgerichtet und konzentriert sich auf den Fotoreporter als sozialen Akteur und seine institutionellen Einbindungen.
Koltermanns Untersuchung basiert auf 40 „qualitativen Interviews“, in denen die Befragten die Möglichkeit haben sollen, „dem Forscher seine Wirklichkeitsdefinitionen mitzuteilen“. Dabei sollen die Gespräche an einem Leitfaden ausgerichtet werden, um eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Interviews herzustellen, erläutert Koltermann in seinem Kapitel zur Methodik, das ebenso wie das Theorie-Kapitel durch ausführliche Verweise auf die Forschungsentwicklung in der Kommunikationswissenschaft, Sozialwissenschaft und anderen relevanten Bereichen gekennzeichnet ist. Befragt wurden internationale, israelische und palästinensische Fotojournalisten.
In zwei eigenen kleinen Bändchen hat Koltermann darüber hinaus seinen Arbeitsprozess dokumentiert. 2014 erschien “Fotografie und Konflikt“, in dem er über die Voraussetzungen von Einsätze in Konfliktregionen nachdenkt. Wie bereitet man sich darauf vor? Wie werden Berichterstatter mit der Kamera selbst zu Akteuren? Zumindest in den Augen der Kriegsparteien, die Berichterstatter_innen immer offensiver angreifen und in ihnen keine neutralen Reporter_innen mehr sehen. Was steckt hinter der Diskussion um „Bilderkriege”, den „Krieg der Bilder” und der „War-Porn”-Debatte? Dabei behandelt er sowohl ethische als auch praktische Fragen zum Verhalten in der Krisenregion bis hin zu Distribution und Publikation der Arbeitsergebnisse. Das Bändchen ist eine Auswahl der Texte aus seinem Blog „Fotografie und Konflikt”. Das zweiten Bändchen von 2015, „Interviews und Gespräche zu Fotografie und Konflikt“, gibt einen direkten Einblick in die Gespräche mit Fotoreportern, aber auch Wissenschaftlern, allerdings nicht nur zum Nahen Osten.
Ein Teil der Interviews, die Koltermann im Nahostkonflikt für seine Doktorarbeit machte, wurde für die Veröffentlichung anonymisiert, weil die Interviewpartner negative Folgen fürchteten, etwa für die Presseakkreditierung oder durch „Media Watchdog“-Gruppen. Einen Akzent seiner Arbeit setzt Koltermann auf die „Macht- und Herrschaftsstrukturen eines Konflikts und ihre Beziehung zur journalistischen Produktion“. Dabei war es ihm wichtig, die Akteurs- von der Bildebene zu trennen, die laut Koltermann aufgrund der „geringen Halbwertszeit des einzelnen Bildes“ sowie der häufigen Unkenntnis darüber, wo die Bilder erscheinen werden, auch der beruflichen Realität vieler Fotoreporter_innen in dieser Region entspreche.
Die Untersuchung zeigt zudem die größeren Handlungsspielräume für internationale und israelische Fotograf_innen gegenüber ihren palästinensischen Kolleg_innen. Diese Aufarbeitung der Produktionsbedingungen könne, so Koltermann in seinem Resümee, auch für die Medienkonsument_innen von großem Interesse sein, weil sie „eine Folie zur Interpretation und zum Lesen des politischen Kontextes von journalistischen Bildern“ biete, die sich, zumindest teilweise, auf andere Konfliktregionen wie Syrien oder Afghanistan übertragen lasse.


