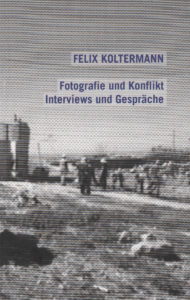Schon 2014 hat der Fotograf und Kommunikationswissenschaftler Felix Koltermann ein kleines Bändchen zum Thema „Fotografie und Konflikt“ herausgebracht. In seinen Texten und Essays beschäftigte er sich mit den ethischen Problemen der Kriegs- und Konfliktfotografie. Jetzt lässt er in einem Folgeband unter dem Titel “Interviews und Gespräche“ Fotografen, aber auch Wissenschaftler direkt zu Wort kommen. Dabei betont er, dass Konfliktfotografie mehr sei als Kriegsfotografie, woran die meisten zuerst denken, da wir mit ihren Ergebnissen täglich konfrontiert werden. Koltermann versteht unter Konfliktfotografie auch die bildnerische Umsetzung sozialer, politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen.
„Die Fotografie ist abgesehen von ihren technischen Voraussetzungen vor allem ein sozialer Prozess“, erklärt Koltermann, sowohl auf der Seite des Fotografen wie des Fotografierten – in diesem Bändchen soll es um die Fotografen in diesem Prozess gehen. Die Interviews und Gespräche stammen aus den Jahren 2014 und 2015.
Michael Kamber hat den Irakkrieg zwischen 2003 und 2012 für die New York Times dokumentiert. Der US-Amerikaner hatte den Eindruck, dass viele Bilder in den USA und Großbritannien zensiert oder unterdrückt wurden nach dem Motto: „Dies ist eine Befreiung, wir wollen, dass Du eine Befreiung fotografierst.“ Dagegen hat er seinen Band mit Interviews von Kriegsfotografen und Bilderstrecken gestellt „Photojournalism on War – The Untold Stories from Iraq“, auf Deutsch erschienen als „Bilderkrieger“. Dabei geht es ihm auch darum, den romantischen Mythos vom Helden mit der Kamera zu zerstören, der gerade für junge Fotografen falsche Signale setze.
Diese Absicht teilt er mit dem deutschen Fotografen Christoph Bangert, der seine Erlebnisse im Irak 2014 in dem Buch „War Porn“ zusammenfasste. Er verweist darin auf die hohen moralischen Ansprüche, auf die erforderliche „Ehrlichkeit“: „Es gibt keine Sonderregelung für den Krieg, auch nicht für Fotografen.“ Leider gebe es aber auch keinen Einfluss der Fotografen auf die Bildauswahl und den Autorenvermerk durch die Agentur oder Redaktion. Deshalb sein Plädoyer für selbst verantwortete Fotobücher, die auch den Betrachter besser zur Reflexion anregten als Fotoausstellungen.
Für den Berliner Kunsthistoriker Tom Holert, Mitgründer des „Institute for Studies in Visual Culture“, hat der erste Golfkrieg 1990/91 mit seinen Fadenkreuz-Bildern aus den amerikanischen Marschflugkörpern eine Zäsur bei den Kriegsbildern gesetzt und die Wahrnehmung von Krieg und Gewalt verändert. Je mehr solcher „Top-Down-Bilder“ gezeigt werden, desto wichtiger würden Bilder vom Boden mit den Auswirkungen dieser unpersönlichen, eher Videospielen gleichenden Aufnahmen.
„Bilder sind Waffen“, sagt der amerikanische Kunsthistoriker W. J. T. Mitchell, dessen Buch „Das Klonen und der Terror – Der Krieg der Bilder seit 9/11“ in deutschsprachiger Ausgabe 2011 erschienen ist. Welch unterschiedliche Auswirkungen sie haben können, zeigten die Folterfotos von Abu Ghraib: Während sie in den USA die Anti-Kriegs-Bewegung stützten, wurden sie in der arabischen Welt zu einem Rekrutierungsinstrument des Jihad.
Wie wichtig die persönliche Zusammenarbeit mit einheimischen Stringern zum Aufbau von Vertrauen zu den Fotografierten in Krisenregionen ist, unterstreicht der Schweizer Werbefotograf und Kriegsdokumentarist Meinhard Schade, der ein Fotobuch über die zerfallende Sowjetunion gemacht hat („Krieg ohne Krieg“).
Der Berliner Fotograf Kai Wiedenhöfer hat in seinem jüngsten Projekt „40 Out of One Million“ Porträts von syrischen Flüchtlingen für einen Bildband angefertigt. Auch für ihn ist die ethische Auseinandersetzung, wie man an Informationen kommen darf und was man zeigen kann, ein essentielles Thema.
In „geschlossenen Städten“ von Flüchtlingscamps in Algerien über Rohstoffstädte in Sibirien bis hin zu „Gated Towns“ für Reiche in Lateinamerika arbeitet der österreichische Architekturfotograf Gregor Sailer – immer beobachtet von Waffenträgern, sei es von Geheimdienst, Polizei, Armee oder Securityleuten. Eine Arbeit, die er durchaus als politisch und nicht nur als Kunst versteht.
Ein durchgängiger Aspekt der Gespräche mit den fünf Fotografen sind die Grenzen der eigenen psychischen Belastbarkeit und der Selbstüberschätzung, bei den Freiberuflern auch die finanziellen Grenzen ihrer Arbeit. Die Frage, wie viel Grausamkeit man den Betrachtern zumuten darf oder soll, wird durchaus kontrovers diskutiert, aber mit ähnlichen ethischen Argumenten begründet. In den Gesprächen mit den beiden Wissenschaftlern steht die Rezeption der Bilder im Vordergrund, so dass sich ein interessanter zweiter Aspekt ergibt. Ein dünnes Bändchen, aber – wie schon das erste von Felix Koltermann – eines, das eine gute Basis für eigene Beobachtungen und Reflexionen bietet.
Felix Koltermann: Fotografie und Konflikt. Interviews und Gespräche. BoD – Books on Demand Norderstedt 2016. 87 Seiten. 6,90, ISBN 978-3-8482-1061-9