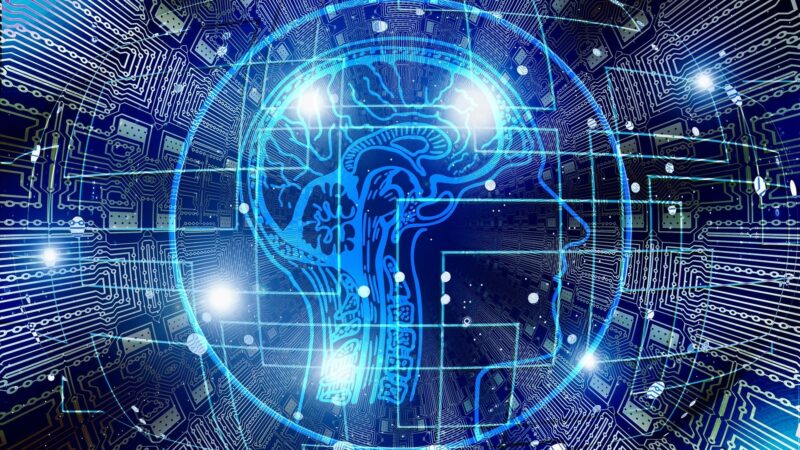Anlässlich des Pariser Friedensforums veröffentlicht Reporter ohne Grenzen (RSF) gemeinsam mit 16 Partnerorganisationen die Pariser Charta für Künstliche Intelligenz (KI) und Journalismus. Sie definiert zehn Grundsätze und Prinzipien, die Journalistinnen und Journalisten, Nachrichtenredaktionen und Medienunternehmen weltweit bei ihrer Arbeit mit künstlicher Intelligenz anwenden können. Erarbeitet wurde die Charta von einer Kommission, die von Reporter ohne Grenzen ins Leben gerufen wurde. Ihren Vorsitz hat die Journalistin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa übernommen.
„KI verschärft eine ohnehin schon existenzbedrohende Situation für den Journalismus. Sie verspricht zwar neue Möglichkeiten, birgt aber auch erhebliche Gefahren für die Integrität der Informationen. Technologische Innovation führt nicht per se zu Fortschritt: Sie muss von der Ethik gesteuert werden, um der Menschheit wirklich zu nutzen“, sagte Maria Ressa, Gründerin und CEO von Rappler und Trägerin des Friedensnobelpreises. Medienschaffende müssten ihre Kräfte bündeln, um sicherzustellen, dass die Verwaltung und Nutzung der transformativsten Technologie unserer Zeit von ethischen Grundsätzen geleitet werde. Die Pariser Charta für KI und Journalismus sei ein wichtiger Schritt in Richtung dieses Ziels, so Ressa. Christophe Deloire, Generaldirektor von Reporter ohne Grenzen betonte: „Die Charta greift journalistische Grundwerte auf und legt besonderen Wert auf die zentrale Rolle der menschlichen Entscheidungsfindung und Verantwortung beim Einsatz von Technologien”, so Deloire.
Die Charta definiere zehn Kernprinzipien zum Schutz der Integrität von Informationen und zur Wahrung der gesellschaftlichen Rolle des Journalismus und sei damit auch eine Reaktion auf die verstärkte mediale Auseinandersetzung mit diesem Thema, heißt es bei RSF. Zu den Kernprinzipien gehören: Grundlage zur Nutzung der Technologie ist die journalistische Ethik. Die Medien sind immer verantwortlich für Inhalte, die sie veröffentlichen und sie wahren Transparenz bei der Nutzung von KI-Systemen. Herkunft und Rückverfolgbarkeit von Inhalten soll sichergestellt werden. Im Journalismus wird eine klare Unterscheidung zwischen authentischen und synthetischen Inhalten gemacht. Journalistinnen und Journalisten, Medienorganisationen und Gruppen, die den Journalismus unterstützen, beteiligen sich an der KI-Governance.
Die Arbeit an der Pariser Charta für KI und Journalismus wurde im Juli 2023 in Partnerschaft mit Organisationen der Zivilgesellschaft, Expertinnen und Experten für künstliche Intelligenz, Medienvertretern und Journalist*innen aufgenommen, darunter auch die Europäische Föderation der Journalistinnen und Journalisten (IJF), deren Mitglied die dju in ver.di ist. Dieser Kommission gehörten 32 prominente Persönlichkeiten aus 20 verschiedenen Ländern an, die auf Journalismus oder KI spezialisiert sind.
Mehr lesen zur KI im Journalismus im M Magazin: https://mmm.verdi.de/ausgaben/heft-3-2023/