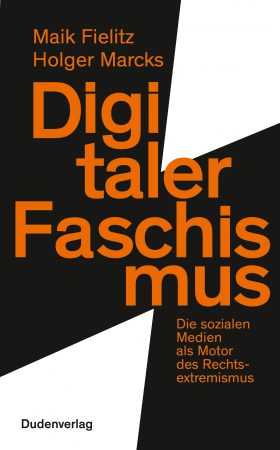Die knallorange Warnfarbe des Buchcovers signalisiert, dass es um etwas Bedrohliches geht: die Demokratie ist in Gefahr, weil Soziale Medien Rechtsextremismus befördern. Konfliktforscher Maik Fielitz und Sozialwissenschaftler Holger Marcks analysieren, wie Rechtsextreme die Funktionsmechanismen digitaler Plattformen nutzen, um ihre faschistischen Bedrohungsmythen zu verbreiten. Sie loten Möglichkeiten zur Rettung des demokratischen Diskurses aus, etwa durch Regulierung der Techunternehmen.
Faschismus definieren Fielitz und Marcks als „soziales Phänomen“: Ultranationalistische Kräfte konstruieren danach eine Realität, nach der das Volk von einer feindlichen Gruppe bedroht wird, gegen die es sich wehren muss. Für ihre Propaganda nutzten die Nazis den „Volksempfänger“ und die Rechtsextremist*innen heute die sozialen Netzwerke. Ihre technologische Struktur bietet ihnen neue Manipulationsmöglichkeiten und führt zu dezentralen Organisationsformen faschistischer Gemeinschaften – von rechten Gruppierungen wie den Identitären bis zur AfD.
Drei Kernkapitel entlarven Techniken
Die Autoren, die zur ersten Generation der digital natives gehören, demonstrieren in drei Kernkapiteln zum aktuellen „digitalen Faschismus“ anschaulich und kenntnisreich, wie die Manipulationstechniken der extremen Rechten mit der Funktionsweise sozialer Medien zusammenspielen und so Bedrohungsängste verstärken, Verwirrung in der Realitätswahrnehmung stiften und ein verzerrtes Bild von politischen Mehrheitsverhältnissen zeichnen.
Durch die Technik des „dramatischen Erzählens“ würden Ängste vor dem „großen Bevölkerungsaustausch“, der Bedrohung des deutschen Volkes durch Fremde, erzeugt. Rechte konstruierten aus der Vielzahl von Nachrichten im Netz eine Realität, die von „Ausländerkriminalität“ beherrscht wird, indem sie passende Lokalmeldungen als national bedeutsam rahmen – etwa die Ermordung einer Jugendlichen durch einen Geflüchteten 2017 in Kandel, die als Folge einer „volksfeindlichen Migrationspolitik“ hochstilisiert wurde.
Da negative Nachrichten in den sozialen Medien häufiger angeklickt und deshalb auch algorithmisch begünstigt werden, entstehe der Eindruck, das Land werde von Gewalt überzogen, obwohl sich die Sicherheitslage statistisch sogar verbessert habe. Was sich in der digitalen Welt aufgeschaukelt hat, reiße normative Leitplanken ein, wenn die „herkömmlichen Medien“ sich gedrängt fühlten, auch „vermehrt die Nationalität vermeintlicher Täter“ zu nennen.
Die „digitale Konjunktur des Postfaktischen“, das eine gefühlte Realitätswahrnehmung adressiert, verstärkt die Technik des „Gaslightning“. Darunter versteht man ein Manipulationsverhalten, mit dem Menschen gezielt desorientiert und verwirrt werden. Die extreme Rechte streut Zweifel an seriösen Quellen, um die von ihr kolportierten Gerüchte, Halbwahrheiten oder Falschmeldungen für die verunsicherten Menschen als real erscheinen zu lassen. Dabei macht sie sich zunutze, dass affektive Fake News in sozialen Medien stärker konsumiert werden als wahre Nachrichten.
Um Reichweite und Glaubwürdigkeit im digitalen Aufmerksamkeitswettbewerb zu erhöhen, erwecken rechte Akteur*innen den Eindruck, ihre Weltsicht sei weit verbreitet. Dabei nutzen sie die Technik der „metrische Manipulation“. Da die Relevanz von Information in sozialen Medien daran gemessen wird, wie viel Zuspruch sie erhalten, versuchen Rechtsextremist*innen das digitale Rating zu manipulieren, indem sie zahlreiche Fake-Accounts einrichten, Likes kaufen und gezielte Online-Kampagnen starten. Wie effektiv diese Technik ist, zeigt das Beispiel „Widerstand 2020“. Mit einem Zähler auf ihrer Homepage erweckte die Partei der „Corona-Kritiker“ den Eindruck, kurz nach Gründung bereits über 100.000 Mitglieder zu haben, sodass bundesweit darüber berichtet wurde – bis sich herausstellte, dass nicht einmal 40 Leute zur Gruppierung zählten.
Verursacher sind schwer zu fassen
Der digitale Faschismus sei dezentral organisiert und in den anonymen Gemeinschaften entwickle sich eine Gewaltkommunikation, die sich in Hasskommentaren entlädt, aber auch zu direkter Gewalt gegen Geflüchtete, Migrant*innen oder Kommunalpolitiker*innen führt, so die Autoren. Diejenigen, die mit „gefährlicher Rede“ zu diesen Taten anstachelten, seien schwer zu fassen.
Die großen Plattformen entziehen sich ihrer Verantwortung, wenn sie den Schutz des demokratischen Diskurses vor Manipulationen und Hass im Netz dem Staat und der Zivilgesellschaft überlassen wollen. Neben der Förderung von Medienkompetenz setzen zahlreichen Initiativen dabei vor allem auf Gegenrede, d.h. alternative Erzählungen, Faktencheck oder Moderation von Kommentaren. Das reiche aber nicht. Die Tech-Unternehmen müssten für die technische Kuratierung der Inhalte verantwortlich gemacht werden und die Mechanismen verändern, die rechte Propaganda befördern. Wenn diese Selbstregulierung nicht funktioniere, seien außer dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Hassrede weitere staatliche Interventionen notwendig. Es sollte auch nicht ausgeschlossen werden, bestehende Plattformen zu sozialisieren oder eine öffentlich-rechtliche Plattform aufzubauen, so Fielitz und Marcks.
Gut lesbar und wissenschaftlich stringent ist die Analyse des digitalen Faschismus, die mit Studien und anschaulichen Beispielen untermauert wird. Die politisch-engagierte Suche der beiden Autoren nach demokratischer Kontrolle sozialer Medien liefert zahlreiche Diskussionsanstöße und ermuntert zum Diskurs – „in guter demokratischer Tradition“.
Maik Fielitz / Holger Marcks: Digitaler Faschismus. Die sozialen Medien als Motor des Rechtsextremismus. Dudenverlag, Berlin 2020, 226 Seiten, 18 Euro, ISBN: 978-3-411-74726-9