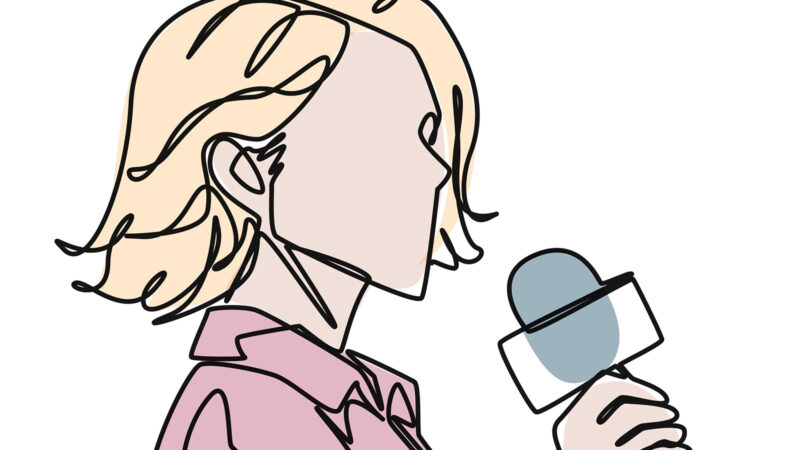Sich als Frau in einer Branche behaupten müssen, in der Durchsetzungskraft und Selbstbewusstsein entscheidende Faktoren sind: Für Generationen von Journalistinnen eine zusätzliche Belastung im ohnehin schon von Konkurrenz und Wettbewerb geprägten Beruf. Angesichts dieser Herausforderung sind Netzwerke und solidarische Bündnisse von großer Bedeutung. Der Journalistinnenbund (JB) hatte hierbei seit seiner Gründung im Jahr 1987 eine Vorreiterrolle inne. Sein Anliegen: Geschlechtergleichstellung in den Medien erreichen.
Der Verein forderte nicht nur eine stärkere Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen oder die paritätische Beteiligung von Frauen im Medienrat, sondern protestierte auch wiederholt gegen Versuche, bestehende frauenpolitische Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder analoge Ressorts in Zeitungen zu kürzen oder zu schließen.
Er verleiht jährlich Preise wie die Hedwig-Dohm-Urkunde, mit der eine Journalistin für ihre herausragende Lebensleistung geehrt wird, wertschätzt junge Journalistinnen für herausragende Reportagen oder vergibt Stipendien an Nachwuchsjournalistinnen. Darüber hinaus wurde beim JB eines der ersten Mentoring-Programme überhaupt ins Leben gerufen. Jedes Jahr werden fünf Tandems angeboten. Das Anliegen, Frauen nicht nur in ihrem Beruf selbst, sondern auch medial repräsentativ und sichtbarer zu machen ist eines, das an Aktualität nicht verloren hat. Das weiß auch die aktuelle Vereinsvorsitzende Friederike Sittler. Sie leitet seit fünf Jahren hauptamtlich die Abteilung Hintergrund Kultur und Politik beim Deutschlandfunk Kultur. Parallel dazu währt ihre Amtszeit beim JB.
„Ich wollte schon, als ich noch Schülerin war, beim JB dabei sein“, erinnert sich die 56-Jährige.
Auch der Berufswunsch stand schon lange fest. Nach dem Studium und der berufsbegleitenden Journalismus-Ausbildung folgte 1995 das Volontariat beim SFB. Damals habe sie den JB lange Zeit aus dem Blick verloren, sagt Sittler. Erst der schnelle Aufstieg in eine Führungsposition im Jahr 2002 habe ihr bewusst gemacht, „wie einsam“ sie als Frau in dieser Rolle gewesen sei. „Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich an den JB erinnert und war dann sehr froh, darin das Netzwerk zu finden, das ich gebraucht habe“, so die Journalistin. (1)
Handreichungen für andere Sprache und Bilder
Seitdem ist viel passiert. In den vergangenen Jahren hat der Verein immer wieder aus gesellschaftlichen Debatten heraus konkretes Handwerkszeug für Medienschaffende entwickelt. Unter anderem mit dem Portal www.genderleicht.de wurden praktische Handreichungen für gendersensible Berichterstattung geschaffen. Es biete, so der JB, „Orientierung, schlagkräftige Argumente, fachlichen Rat und praktische Tools“ – ein Online-Serviceangebot und undogmatische Wissensvermittlung zum Gendern in einem.
Daran anschließend macht der Instagram-Account @bildermaechtig.de auf Klischeefallen bei der Bebilderung journalistischer Texte aufmerksam. Wir alle kennen eine Bildsprache, die überkommene Rollenbilder, mitunter Sexismus zeigt und dem kulturellen Wandel, neuen Frauenrollen und der Diversität in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft nicht gerecht wird: zum Thema Krankenhaus spucken Bilddatenbanken klischeehafte Bilder mit einer geschminkten jungen Patientin und einem männlichen Arzt als aktivem Helfer aus. Beiträge zu „Führungsfrauen“ zeigen Beine in Pumps unter einem Rock zwischen Anzughosen, zum Thema Urlaub gibt es „Bikini-Schönheiten“. Männer im Vordergrund, Frauen in aufschauenden Posen: keine seltene Bildkomposition.
Ein aktuelles und konkretes Beispiel bringt auch Friederike Sittler: „Es gab mit der letzten Bundesregierung zunächst ein paritätisch besetztes Kabinett, aber abgebildet wurden fast immer nur drei Männer“ – ein Sinnbild. Das männliche Trio inszeniert die Frauen in der Regierung, sie bleiben unscharf und nicht beachtet: Der Verantwortung, die Wirklichkeit abzubilden, werden Medien damit nicht gerecht. Hier fordert nicht nur der JB sichtbare Veränderungen – zumal angesichts der Herausforderungen des derzeitigen konservativ-autoritären Backlashs.
JB als gefragtes Gegenüber
Welche messbaren Erfolge der JB vorzuweisen hat, verraten wachsende Reichweiten in den Kanälen der Sozialen Medien wie Instagram, LinkedIn und Youtube, so Sittler. Der JB-Newsletter werde nicht nur abonniert, sondern laut Webstatistik auch überdurchschnittlich oft gelesen. Vieles passiere zudem hinter den Kulissen, erklärt die Vorsitzende. „Wir sehen, wer bei unseren Tagungen sitzt – da sind beispielsweise Verantwortliche von ARD, ProSieben, dem Tagesspiegel und dpa-.“ Aber auch Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, oder Ferda Ataman, unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung und Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wertschätzen den Verein und seine Veranstaltungen.
Kontroverse um Franziska Becker
Eine dieser sorgte allerdings 2019 für eine Kontroverse, die bis heute nachwirkt. Damals erhielt die Emma-Karikaturistin Franziska Becker vom damaligen Vorstand die Hedwig-Dohm-Urkunde für ihr Lebenswerk. Becker hat eine ganze Reihe von Karikaturen veröffentlicht, die ihr den Vorwurf einbrachten, antimuslimischem Rassismus Vorschub zu leisten, vor allem indem sie kopftuchtragende Frauen mit islamistischem Fundamentalismus – und zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auch islamistischem Terror – in Verbindung brachte. Vor allem in einer deutsch-sprachigen Telegram-Gruppe, in der sich seit dem Frauenstreik am 8. März 2018 inzwischen über 1.800 Journalistinnen vernetzen, gab es dazu große Kritik, verbunden mit der Forderung, den JB hinsichtlich seiner Vergabe- und Förderpraxis stärker zur Diskussion zu stellen bis hin zu der, seine Ausschreibungen nicht mehr zu teilen.
Sibel Schick schrieb damals recht pointiert zu Franziska Becker: „Während man viele ihrer Zeichnungen als Islamismuskritik sehen kann, bedient sich die Karikaturistin nicht selten auch islamfeindlicher Klischees. Hierbei geht es um die Karikaturen, in denen sie Frauen mit Kopftuch behandelt, eine ohnehin massiv diskriminierte Minderheit in Deutschland. In vielen dieser Zeichnungen gelingt es ihr nicht, patriarchale Strukturen differenziert darzustellen, ohne zu der Diskriminierung von Frauen mit Kopftuch beizutragen.“(2)
Mehr Solidarität, weniger Vorwürfe
Man merkt Friederike Sittler an, dass ihr die mit ihrer Wahl zur Vorsitzenden geerbte Kontroverse einiges an Kraft und Nerven abverlangt hat. „Der Vorwurf, der JB sei rassistisch, ignoriert vollkommen, wie divers und vielfältig wir sind.“ Der Verein habe damals umgehend intern und öffentlich diskutiert, ohne das Thema abzuschließen. Die kritisierten Zeichnungen stammten aus dem Jahr 2003, die Auszeichnung von Becker sei über 15 Jahre später erfolgt. „Vielleicht hat man 2003 auch noch anders gezeichnet“, gibt Sittler zu bedenken. Der JB habe die Debatte und die Auseinandersetzung gesucht, sei dabei aber auch auf viel Ablehnung gestoßen. Aber eine derart kontroverse Diskussion allein in sozialen Medien und über statt mit dem Verein zu führen, sei nicht richtig, findet die JB-Vorsitzende und gibt zu bedenken: „Religiösen Fundamentalismus zu verharmlosen ist gefährlich und das gilt für alle Religionen“. Sittler selbst ist Theologin, Katholikin, mit einer Frau verheiratet.
„Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig zerfleischen. Die gesellschaftspolitischen Entwicklungen zeigen, dass wir wieder stärker zurück zu Solidarität und mehr Verständnis auch für unterschiedliche Positionen untereinander kommen müssen“, erklärt die JB-Vorsitzende. Ihr Verein biete dafür eine Plattform. Sowohl Reformen im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als auch rechtsautoritäre Angriffe auf den ÖRR werden die zukünftigen Arbeits- und Produktionsbedingungen erschweren. Errungenschaften wie Gleichstellungsbeauftragte im ÖRR seien dann keine Selbstverständlichkeit mehr.
Frauenanteil sinkt
Auch der Verein Pro Quote hat kürzlich erhoben, dass der Anteil weiblicher Führungspersonen in den bundesdeutschen Medien weiter sinkt. Zu den dabei untersuchten Leitmedien zählen Bild, Spiegel, Focus, Stern, Zeit, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt – und seit 2021 die tageszeitung. Eine Frauenquote, wie sie angestrebt wird, erreicht nach den Erhebungen von Pro Quote einzig die taz mit 65 Prozent Frauenanteil in der Belegschaft. Die Geschlechtergerechtigkeit ist innerhalb deutscher Print- und Online-Leitmedien also rückläufig. Diesen Trend aufzuhalten, sind Frauennetzwerke im Journalismus nach wie vor gefragt.
(1) Pro Quote gibt es erst seit 2012. Der Verein Pro Quote Medien, der sich explizit zur Aufgabe gemacht hat, dafür zu sorgen, dass Führungspositionen paritätisch besetzt werden, war 2002 noch nicht gegründet. Mehr weibliche Perspektiven, faire Bezahlung und eine 50-50 Quote in den Führungsetagen sind die Hauptforderungen des Vereins.
(2) Ein anderer Kritikpunkt sieht den JB im Zusammenhang mit einer misgendernden Praxis in der Sprache von Ausschreibungen und auch Programmen.