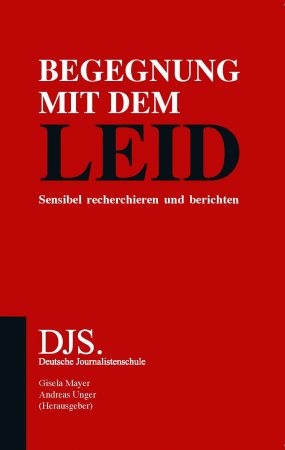„Mitmenschlichkeit, Empathie ist in vielen Fällen ein guter Ausgangspunkt für Qualitätsjournalismus“, so Jörg Sadrozinski, bis Juli 2017 Leiter der Deutschen Journalistenschule DJS in München, die das Buch verlegt hat. Wie guter Journalismus gelingen kann, thematisieren Gisela Mayer und Andreas Unger in „Begegnung mit dem Leid“ an der Berichterstattung über Menschen, die durch Unfälle, Attentate oder persönliche Schicksalsschläge seelisch stark belastetet sind.
„Jetzt weinen Sie doch mal, Frau Mayer, das muss emotional sein, sonst interessiert es die Leute nicht.“ Mit Schrecken erinnert sich Gisela Mayer an die Reporterin eines privaten Senders, die sie interviewte, nachdem ihre Tochter 2009 beim Amoklauf in Winnenden getötet wurde. Mayer, die nach ihren Medienerfahrungen als Ethiklehrerin auch Nachwuchsjournalist_innen im Rahmen von Interviewtrainings in sozialsensibler Berichterstattung schult, hat den schmalen Band gemeinsam mit Sozialjournalist Andreas Unger herausgegeben.
Die Publikation entstand auf Grundlage des DJS-Unterrichtsmoduls „Interview mit Traumatisierten“ und setzt sich aus fünf jeweils mit einer Leitfrage überschriebenen Kapiteln zusammen, die aus verschiedenen Perspektiven auf die Berichterstattung blicken. Außer Mayer und Unger schreiben die Traumaexperten Oliver Schwarz und Aram Baklayan, die Gießener Kriminologin Britta Bannenberg und der Psychologe und Arabist Ahmed Hussein.
Es geht um Grenzverletzungen, aber vor allem auch um Positiv-Beispiele. So sind sich Mayer und Unger einig, dass gute Gespräche zwischen seelisch stark belasteten Menschen und Journalist_innen „auf Augenhöhe“, respektvoll und mit einem klar formulierten Berichterstattungsinteresse stattfinden sollten, z.B.: „Guten Tag, mein Name ist Andreas Unger, ich bin Journalist von Beruf und im Auftrag von … hier. Ich möchte den Menschen erzählen, was passiert ist.“ Wenn der oder die Betroffene zu einem Gespräch bereit ist, sei es wichtig, ernsthaftes Erkenntnisinteresse zu zeigen. „Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, aber meistens verläuft das Gespräch ganz anders, und das ist gut so“, zitiert Unger seine einleitenden Worte. Dann lege er den Zettel zur Seite und signalisiere, dass er sich zwar vorbereitet habe, aber offen für sein Gegenüber sei.
Mit der Berichterstattung über Gewalttaten, in der Journalist_innen oftmals (unbewusst) Erwartungen der Täter_innen bedienen, befasst sich ein Beitrag von Britta Bannenberg, Professorin an der Universität Gießen, die eine kriminologische Analyse von Amoktaten erstellt hat. Bei der Auswahl von Bildern zur Illustration nutzten einige Medien z. B. Fotos aus dem Internet, „auf denen sich Täter selbst inszenieren: im schwarzen Trenchcoat, Waffen in der Hand, mit unbewegter, martialischer Miene“. Andere griffen dagegen auf Passfotos zurück, „auf denen die Täter aussehen wie so viele andere Pubertierende: mit Pickeln, einer sperrigen Brille und einem freundlich ungelenken Lächeln. Eine Redaktion, die diesem Bild den Vorzug gibt, drückt damit aus: Wir gehen deiner Selbstinszenierung nicht auf den Leim“.
Das Buch enthält interessante Tipps für Journalist_innen, doch außer der Forschungsarbeit von Bannenberg gibt es leider keine weiteren Hinweise auf Literatur wie etwa die Studie „The Emotional Toll On Journalists Covering The Refugee Crisis“. Wünschenswert wären auch Informationen über Lehrfilme oder Schulungen für Medienschaffende zum relevanten und aktuellen Thema Trauma und Journalismus.