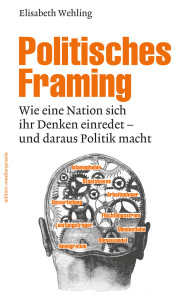In der politischen Debatte sind nicht die Fakten entscheidend, erklärt die Hamburger Journalistin und Kognitionsforscherin in Berkeley, Elisabeth Wehling, in ihrem neuen Buch „Politisches Framing – Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht“. Den entscheidenden Einfluss üben die gedanklichen Deutungsrahmen aus, die von der kognitiven Wissenschaft Frames (Rahmen) genannt werden. Diese Frames entstehen aus unserer Vorerfahrung, aus unserem abgespeicherten Wissen.
Dabei sind diese Frames selektiv, sie können in unserem Denken durch Sprachbilder, die Metaphern, automatisch und unbewusst positive oder negative Aspekte ausschließen. Auch Frames aus ideologischen Kontexten, die der Leser oder Hörer eigentlich ablehnt, wirken auf ihn ein, weshalb es wenig sinnvoll ist, in Debatten mit dem politischen Gegner dessen Begriffe zu verwenden, da die Frames im Gehirn auch dann aktiviert werden, wenn man sie in Abrede stellt und bekämpft. Nur zwei Prozent unseres Denkens, so Wehling, sei nämlich wirklich bewusst.
Seit dem Wahlsieg von Barack Obama mit seiner Kampagne/seinem Frame „Yes, we can“ wird Framing von progressiven Politikern als Geheimrezept betrachtet – die Kognitionsforscher sind als „Framing Docs“ in der US-Politik im Kommen. Denn wo die Worte fehlen, können auch die Gedanken nicht etabliert werden. Für die Forscher eine Situation der Hypokognition: Es entsteht ein gedankliches Vakuum, weil Fakten nicht eingebettet in der beabsichtigten ideologischen Weltsicht referiert werden. Oder, wie Wehling resümiert: „Fakten ohne Frames sind bedeutungslos.“
Im zweiten Teil ihres Buches führt Wehling ausgewählte Beispiel-Frames aus der aktuellen Debatte vor. Sie zeigt dabei auch, wie sich Frames verändern können. So hat seit den 1970er Jahren in der Bundesrepublik die Vorstellung des Staates als Dienstleister den Begriff des Obrigkeitsstaats ablösen sollen. Doch wenn der Staat der Dienstleister ist, dann ist der Bürger als sein Kunde König und fühlt sich als Steuerzahler ausgequetscht, so dass er Zuflucht suchen muss in Steuerasylen oder –paradiesen. Ein Frame, der automatisch für Verständnis mit dem Steuerflüchtigen sorgt. Dass der Steuerzahler eigentlich ein Steuerbeitragender ist, also an einer Gemeinschaft auch zum eigenen Wohl teilnimmt, wird dadurch gedanklich ausgesperrt.
Ein aktuelles Beispiel ist „Islamischer Staat“, egal ob in Anführungszeichen oder abwertend gebraucht, Die Bilder in unseren Köpfen sind immer die des Terrors. „Islam“ ist ein Contested Concept, also ein Frame, der sehr abstrakt und mit ganz verschiedenen Konnotationen füllbar, nachfüllbar und veränderbar ist. Er lässt viel Platz für ideologisches Framing. Durch die ständige Verbindung von Islamischer Staat und Terror werden die neuronalen Verbindungen von Islam zu Terror ausgebaut und verfestigt. Auch der zweite Teil des Begriffs, „Staat“, ist bedenklich, weil es „in vorauseilendem Gehorsam“ einer Terrormiliz eine Staatlichkeit zugesteht, ebenso wie „Gottesstaat“ oder „Gotteskrieger“: „Alles zusammen betrachtet könnte man sagen: Unsere Debatten heben den radikal-islamistischen Terrorismus höchst gekonnt – und mit Sicherheit ebenso höchst ungewollt – als Prototypen des Islam, als ideale, wenn nicht gar einzige Version dieser Religion, auf einen kognitiven Sockel.“
Ein letztes Beispiel seien die häufig gebrauchten Begriffe in der Asyl- und Zuwanderungspolitik: Volles Boot, Masse, Flut, Tsunami, Strom. Kommen Zuwanderer, ist unsere Nation nicht ein stolzes Schiff, sondern ein gefährdetes Boot. Flüchtlinge als Welle und Flut, also als Naturkatastrophe, brechen über die Einheimischen herein, die gedanklich zum Opfer werden, die Flüchtlinge aber zur Bedrohung: „Der Frame nimmt uns damit die gedankliche Grundlage zu Empathie mit dem einzelnen Flüchtling und seinem Schicksal und lädt uns stattdessen zu Empathie mit der betroffenen Bevölkerung ein.“
Wehling fordert uns auf, Aufmerksamkeit zu zeigen, wo sich etablierte oder sich etablierende Begriffe über die Lager hinweg ausbreiten, auch da, wo es eigentlich ideologische Vielfalt geben sollte, sogar da, wo „sie politischen Faktenlagen oder gar unseren Normen und Gesetzen widersprechen.“ „Augen auf bei der Wortwahl“ bedeuten die Erkenntnisse der Kognitionsforschung für Politiker und Journalisten, die nicht ungewollt Ideen transportieren wollen, die sie eigentlich gar nicht vertreten. Das macht mehr Mühe, als die abgedroschenen Begriffe zu verwenden, aber es sollte sich lohnen.