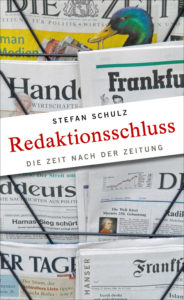Der frühere FAZ-Autor Schulz intoniert einen Grabgesang auf die gedruckte Zeitung, im Grunde auf das Medium Tageszeitung insgesamt. Den Verlegern und Journalisten attestiert er Blindheit und Unverständnis der technologischen Entwicklung, die seiner Ansicht nach den Untergang des Mediums unweigerlich nach sich ziehen: „Statt dass Zeitungsverlage in gut funktionierende technische Verfahren des digitalen Zeitungsvertriebs investieren, durch die sie wieder in eine Beziehung zu ihren Lesern treten, setzen sie auf die Laufkundschaft der sozialen Netzwerke und Werbeerlöse im Massenmarkt.“
Der Titel des Bands ist wörtlich gemeint. Die Totengräber sind – man hat es geahnt – Google und Facebook. Die Abhängigkeiten von den Internetgiganten wachsen. „Der organisierte Journalismus ist nicht nur beim Vertrieb seiner Produkte auf die Dienste der neuen Informationsanbieter angewiesen, sondern schon bei ihrer Herstellung.“ Die Pluralität der Medienwelt werde heute von Google gestaltet. Der Journalismus werde deinstitutionalisiert, seitdem Zeitungen ihre Artikel auf Facebook veröffentlichen oder die Verlage ihre Inhalte selbst auf die Server von Facebook laden. Das einzelne Medium als Marke verschwinde, die Identitätspflege funktioniere kaum noch, wenn die meisten Produkte ohnehin auf Facebook landen. Damit übernehme das Netzwerk auch die Rolle des Gatekeepers: Nicht mehr die Verleger/Journalisten entscheiden über die Relevanz von Informationen, sondern die Facebook-Algorithmen. Eine Klickzahlen messende Software wie „Chartbeat“ habe in vielen Verlagen längst mehr Einfluss auf die Linie des Blattes als das journalistische Spitzenpersonal. Journalistische Kriterien, erst recht hehre Grundsätze wie Glaubwürdigkeit und Seriosität, spielten tendenziell kaum noch eine Rolle. Sie seien den eher unterhaltungsorientierten Lesern meist auch egal. Ohnehin werde es unter den verschlechterten ökonomischen Bedingungen für die Medien immer schwerer, ihren Auftrag – Information, Aufklärung, investigative Recherche – angemessen zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund spekuliert Schulz auf ein Ende der „Gutenberg-Galaxis“.
Gibt es Hoffnung auf Rettung? Einen praktikablen Rat weiß auch der Autor nicht. Der Vorschlag, das Publikum solle sich eine „Nachrichtendiät“ verordnen, vermag nicht wirklich zu überzeugen. Außerdem: Gibt es nicht – trotz Google und Facebook – genügend Quellen und journalistische Produkte, Portale, Blogs und – ja, sogar vereinzelt Printmedien – die Orientierung in einer allerdings immer disparater wirkenden Welt schaffen? Dass der Zugang zu diesen „alternativen“ Medien künftig das Privileg einer Minderheit werden könnte, ist allerdings eine andere Frage.
Stefan Schulz: Redaktionsschluss. Die Zeit nach der Zeitung. Carl Hanser München 2016. 304 Seiten, 21,90 Euro, ISBN: 978-3-446-25070-3