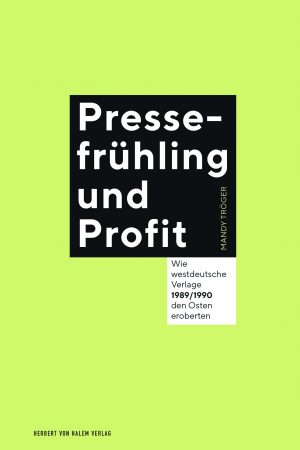Im Namen von Pressefreiheit und Medienvielfalt sollte 1989/90 in der DDR das politische Monopol der SED aufgebrochen werden. Doch stattdessen entstanden neue wirtschaftliche Monopolstrukturen. Die vielen Reformprojekte erlebten nur einen kurzen „Pressefrühling“ und wurden durch „eine marktgesteuerte Pressereform ignoriert oder plattgemacht“, so Mandy Tröger, die in ihrem Buch gängige Erklärungen für das Pressesterben in Ostdeutschland hinterfragt.
Die Kommunikationswissenschaftlerin und Historikerin Mandy Tröger ist in Ost-Berlin aufgewachsen und analysiert die Situation der DDR-Presse zwischen dem 9. November 1989 und dem 3. Oktober 1990 aus einer ostdeutschen Perspektive. Dabei zeigt sich deutlich, welche medienpolitischen Chancen durch die vorschnelle „Wiedervereinigung“ verpasst wurden. Als DDR-Reformer*innen ein Mediengesetz für Ostdeutschland ausarbeiteten, fokussierten sie z.B. die innere Pressefreiheit, d.h. sie wollten die Entscheidungsautonomie und Verantwortung der Journalist*innen stärken. In der bundesdeutschen Gesetzgebung hat dagegen die äußere Pressefreiheit durch den Tendenzschutz der Verlage Vorrang.
Tröger recherchierte in elf Archiven und interviewte 17 vor allem ostdeutsche Zeitzeug*innen, um die „marktgetriebene Presse-Wende im Osten Deutschlands“ akribisch am Beispiel des Presse-Vertriebs nachzuzeichnen. Chronologisch dokumentiert sie die Rolle einzelner Akteur*innen und resümiert, dass die gängige Geschichtsschreibung „angepasst, umgeschrieben oder komplett gestrichen werden muss“. So war es nicht das DDR-Postministerium, das Gruner+Jahr, Bauer, Springer und Burda um Hilfe beim Vertrieb – auch westdeutscher Presseprodukte – bat, sondern die Großverlage selber wurden bereits wenige Tage nach dem Mauerfall vorstellig, um eigene Konzepte für Joint Ventures anzubieten. Die „frühe, massive Lobbyarbeit der Verlage“ habe dazu beigetragen, dass keine eigenen DDR-Reformkonzepte zu Presseimport und -vertrieb entwickelt wurden, sondern das Konzept G+J als Grundlage der Diskussionen diente.
M – Der Medienpodcast: einzigartig anders, denn wir fragen genauer nach.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Die DDR-Regierung stand unter zeitlichem Reformdruck, da die Bevölkerung nach Zeitungen und Magazinen aus dem Westen verlangte. Institutionen wie der Medienkontrollrat und das Ministerium für Medienpolitik oder der Runde Tisch waren machtlos, als die vier Großverlage den ostdeutschen Pressemarkt unter sich aufteilten, mit eigenen Titeln fluteten und sich schnell mit Dumpingpreisen Konkurrenz machten. Sie kooperierten mit dem Postzeitungsvertrieb (PZV) der DDR, der um seine Existenz fürchtete, und nutzten dessen Monopolstrukturen für den Aufbau der eigenen Marktbeherrschung. DDR-Zeitungen verschwanden in den Kiosken unter den Westpresse-Auslagen, ihre Abonnent*innen wurden erst verspätet oder gar nicht beliefert. Statt der immer wieder angeführten „Anpassungsprobleme“ an westliche Standards habe vor allem dieser Vertriebsboykott das Überleben der Ost-Presse erschwert, so Tröger. Den Skandal machten die DDR-Zeitungen sogar publik, blieben jedoch ungehört.
Tröger deckt auch die unrühmliche Rolle des Bundesinnenministeriums (BMI) auf. Mit Blick auf die Einheit sorgte es dafür, dass DDR-Reformbestrebungen in die etablierten Strukturen der Bundesrepublik passen. So begrüßte das BMI zunächst, dass die vier Großverlage den Vertrieb von Westpresse eigenmächtig organisierten – trotz rechtlicher Grauzone.
Das Buch, das auf Trögers Dissertation basiert, liest sich spannend wie ein Krimi. Ihre andere Perspektive auf die Presse-Wende in der DDR belegt sie mit einem 70 Seiten starken Quellennachweis. Eine Fundgrube für alle, die sich für die damaligen „radikal-demokratischen Visionen einer freien Presse“ interessieren und wie ihre Umsetzung verhindert wurde!
Mandy Tröger: Pressefrühling und Profit. Wie westdeutsche Verlage 1989/1990 den Osten eroberten. Herbert von Halem Verlag Köln 2019, 360 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-86962-474-7