Die deutsche Filmgeschichte kennt viele Gesichter, Stars und Sternchen. Wer von ihnen jedoch jüdisch war, blieb meist im Verborgenen. Im Rahmen des Forschungsnetzwerks „Deutsch-jüdische Filmgeschichte der BRD“ ist nun eine besondere Form kollaborativen Schreibens erschienen. Gut ein Dutzend Autor*innen sammelten Anekdoten, historiografische und biografische Bruchstücke von Juden und Jüdinnen in Film und Fernsehen, eben Einblendungen auf die bundesdeutsche Geschichte nach 1945.
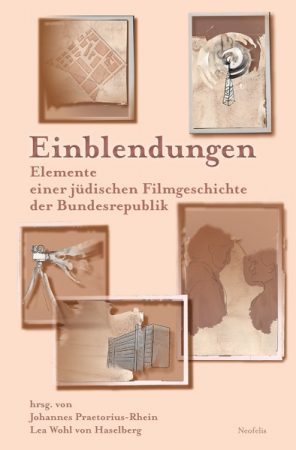
„Morituri“ etwa von 1948. Es war der erste deutsche Spielfilm, in dem ein KZ gezeigt wurde, die Flucht und das Untertauchen einer Gruppe Verfolgter. Produzent Artur Brauner wollte seinen ersten Film unbedingt über und für die wehrlosen NS-Opfer drehen. Dass Brauner verfolgter Jude war, wollte im Nachkriegsdeutschland aber kaum jemand wissen. Sein Geld verdiente Brauner alsbald auch nicht mit anklagenden, sondern mit Unterhaltungsfilmen. Old Shatterhand und Winnetou eben.
Es gab zwar Juden im deutschen Film nach 1945, doch selten traten sie als solche öffentlich in Erscheinung. Imo Moszkowicz musste während des Krieges Zwangsarbeit leisten. Nach dem Krieg wurde er Regieassistent bei Gustaf Gründgens, drehte Komödien mit Heinz Rühmann. Eben jenen Menschen, die schon in Nazideutschland Erfolge feierten. Moszkowicz starb 2011. Er stellte immer nur seine Erfolgsgeschichte als Kind aus armen Verhältnissen in den Vordergrund. Erst im Alter konnte er zugeben, NS-Opfer gewesen zu sein. Erst spät nahm er als Zeitzeuge an Gedenkveranstaltungen teil.
Beim Publikum fand eine kritische Aufarbeitung der NS-Zeit dagegen kaum statt. Im Magazin „Stern“ erschien 1955 bis 1957 die Rubrik „Das gab’s nur einmal“. Später wurde daraus ein Buch als eine Art „Standardwerk“ früher Filmgeschichte. Der Autor war Curt Riess, selbst Jude, der aber mit der UfA-Schauspielerin Heidemarie Hatheyer verheiratet und mit Gustaf Gründgens, Hans Albers und anderen UfA-Größen befreundet war. Keiner von ihnen wollte Nazi gewesen sein. Riess übernahm deren Selbststilisierung als Opfer im „inneren Widerstand“, als hätten sie nicht anders gekonnt, um zu überleben.
Schließlich gab es auch die, die ihr Judesein nicht versteckten. Peter Lilienthals Familie floh aus Nazi-Deutschland nach Uruguay, als er zehn Jahre alt war. „David“ beschreibt junge Juden in der landwirtschaftlichen Vorbereitung auf ihre Alija nach Palästina. Mit „David“ gewann Lilienthal bei der Berlinale 1979 den Goldenen Bären. Er blieb aber Außenseiter, wurde nie Teil des neuen deutschen Autorenkinos, das nach der 1968er-Revolution mehr nach den Täter-Vätern fragte als nach den jüdischen Opfern.
Immer wieder gab es die „jewish moments“, kaum zu erkennen, aber dennoch da. Die Geschichte hinter den „Münchner Geschichten“ von 1974-1975 etwa. Regisseur Helmut Dietl wollte Towje Kleiner als Hauptdarsteller, aber der war dem Bayerischen Rundfunk „zu jüdisch“ aussehend und wurde abgelehnt. Ein klarer Fall von Antisemitismus. Immerhin durfte Towje Kleiner dann den Taxifahrer Achmed spielen, einen Türken.
„Einblendungen“ gibt somit zahlreiche Einblicke auf die jüdischen Momente im deutschen Film und Fernsehen. Eine spannende und manchmal erschreckende Entdeckungsreise.
Johannes Praetorius-Rhein / Lea Wohl von Haselberg (Hrsg.): Einblendungen. Elemente einer jüdischen Filmgeschichte der Bundesrepublik, Jüdische Kulturgeschichte in der Moderne, Bd. 27, Neofelis Verlag, 186 Seiten, mit 5 Illustrationen, ISBN: 978-3-95808-413-1, 14 Euro


