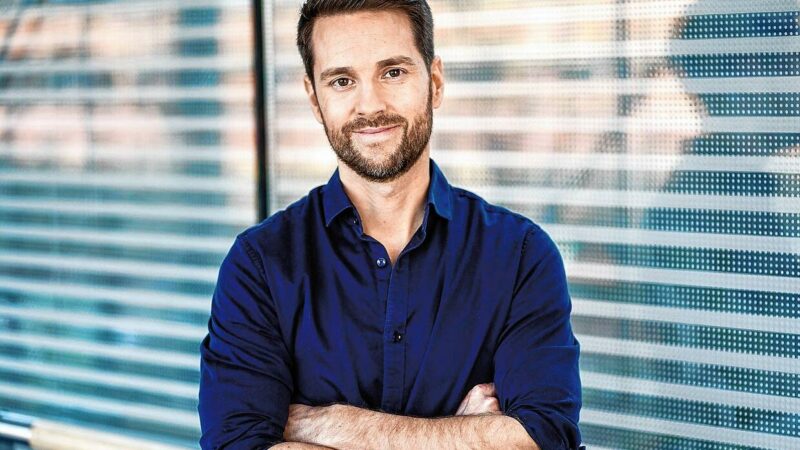Mirko Drotschmann ist Journalist, YouTuber und Webvideoproduzent mit den Schwerpunkten Geschichte, Politik und Gesellschaftsthemen. Der Moderator von „Terra X“ oder „MrWissen2Go“ ist sich sicher, dass Journalist:innen und Influencer:innen voneinander lernen und sich gegenseitig befruchten können. Auf keinen Fall sollten die einen auf die anderen herabschauen.
Influencer:innen sind immer enger in die Produktion, besonders beim ÖRR, eingebunden. Wo verlaufen nach Ihrer Einschätzung aktuell die Trennungslinien zwischen Journalist:innen und Influencer:innen?
Der Sammelbegriff der Influencer kann auch Journalisten einschließen, die eine klassische journalistische Ausbildung absolviert haben und gleichzeitig mit einer hohen Reichweite im Netz unterwegs sind. Ich selbst bin ja auch journalistisch ausgebildet worden und war schon lange vor meiner Zeit bei YouTube für „konventionelle“ Medien tätig. Dann haben sich die beiden Bereiche ganz natürlich miteinander verwoben.
Ein anderer Fall sind Menschen, die sich zunächst im Social Media-Bereich Reichweite aufgebaut haben und dann in journalistische Formate – oft bei den Öffentlich-Rechtlichen – hineinkommen. Sie sind dann dort in redaktionelle Strukturen eingebunden, die sich um die journalistische Gestaltung der Inhalte kümmern, während die Influencer sich vor allem um die Präsentation vor der Kamera kümmern.
Hier sehe ich die Trennlinie: Auf der einen Seite Journalisten mit Vorerfahrung und Ausbildung, die in den sozialen Medien aktiv werden. Sie können selbst auch etwa Drehbuch und Recherche übernehmen. Auf der anderen Seite Influencer, die redaktionell eingebunden sind und eher präsentieren.
Wo und wie können beide Gruppen voneinander profitieren?
Man kann definitiv voneinander profitieren. Influencer, oft als Ein-Mann- oder Eine-Frau-Team unterwegs, beherrschen teilweise eine sehr dynamische und unkonventionelle Produktionsweise. Ich selbst habe bei meiner YouTube-Produktion immer geschätzt, dass ich mein eigener Herr war und Inhalte nach meinem Gusto erstellen konnte. Diese agile Produktionsweise ist sehr direkt und denkt nicht in verschachtelten Strukturen. Davon können sich Redaktionen inspirieren lassen.
Umgekehrt können Influencer von Redaktionen Dinge lernen, wie etwa redaktionelle Planung, strategisches Denken, das Vier-Augen-Prinzip oder die klassische journalistische Sorgfaltspflicht. Sie pflegen manchmal so ein „in den Tag hinein“-Produzieren und können von der planvollen redaktionellen Vorgehensweise sicher profitieren, um ihre eigenen Produktionen stärker zu machen.
Welches sind für Sie die wichtigsten Dos and Don’ts in der Zusammenarbeit der beiden Gruppen?
Für mich ist es ein wichtiges Don´t nicht auf die jeweils andere Gruppe herabzuschauen. Influencer sollten Journalisten nicht geringschätzen, weil sie sich unter Umständen etwas auf ihre Reichweite einbilden. Umgekehrt sollten Journalisten angesichts der Arbeit von Influencern nicht die Nase rümpfen, unter dem Motto “Die machen doch nur Schminktipps“. Das Feld hat sich inzwischen sehr geweitet und es gibt dort inzwischen sehr interessante Vertreter.
Entsprechend wäre es ein wichtiges Do, offen zu sein für die Entwicklungen auf der jeweils anderen Seite. Sich die besten Dinge abzuschauen und die schlechten nicht zu übernehmen. Vor allen Dingen sollte man auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Ein Don´t wäre, dass man nicht zu zahlenfixiert sein sollte. Im Netz geht es vor allem um Aufmerksamkeit, um Klicks und Likes und um Wahrnehmung. Eine geringe Quote hat bei Influencern eine direkte Auswirkung auf ihre Reichweite und somit auf ihre Einnahmen.