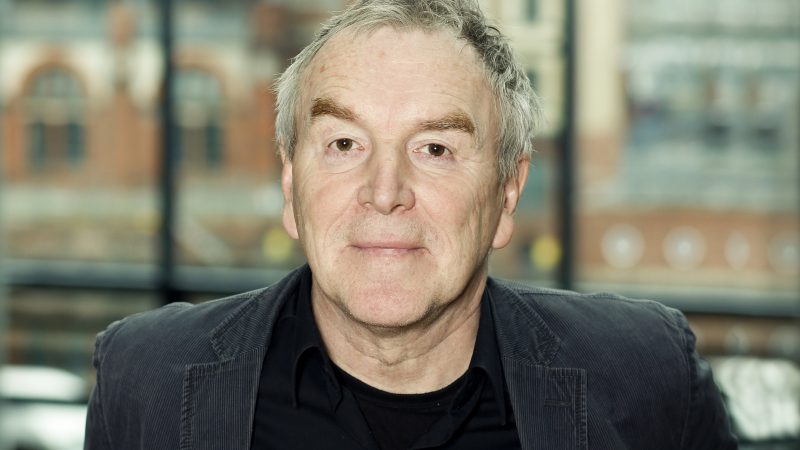„Alternative Fakten“ ist das Unwort des Jahres 2017. Der von Trump-Beraterin Kellyanne Conway geprägte Begriff steht nach Auffassung der Jury für den Versuch, „Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen“. Und damit ganz in der Tradition des „Neusprech“ in George Orwells Klassiker „1984“.
Noch andere zweifelhafte Wortschöpfungen und Begriffe haben es auf die Shortlist geschafft: „Fake News“, vom Regenten im Weißen Haus höchstselbst inflationär eingesetzt, um ihm nicht genehme wahre Fakten zu leugnen, zu diskreditieren, an den Pranger zu stellen. Dazu gehörig die so genannte „filter bubble“ oder Filterblase, ein Phänomen, das die algorithmengestützte Neigung von immer mehr Zeitgenossen beschreibt, nur noch Informationen aufzunehmen und gutzuheißen, die kompatibel sind mit dem eigenen beschränkten Weltbild. Also das Gegenteil von Kommunikation und Erkenntnisinteresse. In Deutschland hat die Pegida-Fraktion vor geraumer Zeit – allerdings in der Tradition der NS-Propaganda – den Begriff Lügenpresse wieder eingeführt, als despektierlichen Kampfbegriff gegen jede Berichterstattung, die sich dem braunen Gebräu aus Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Verherrlichung des „Bio-Deutschtums“ publizistisch nicht anschließen mag.
Nun also „alternative Fakten“. Dass es eine absolute Objektivität nicht gibt, weiß jeder Journalistik-Student hoffentlich spätestens im zweiten Semester. Immer gilt es, durch sorgfältige Recherche der Realität möglichst nahe zu kommen. Der Begriff „alternative Fakten“ suggeriert dagegen eine gewisse Beliebigkeit in der Wahrnehmung von Welt. Nach dem Muster: Was mir nicht passt, wird passend gemacht – auch jenseits aller Empirie. Dann verwandelt sich die Manifestation bei der Amtseinführung des Präsidenten eben in die größte Versammlung ever, auch wenn auf dem Platz vor dem Kapitol überdeutlich sichtbar große Lücken in der akklamierenden Menge klafften.
Dabei sind der Machthaber im Weißen Haus und seine PR-Vasallen nicht die Erfinder dieser Technik. Selbst in deutschsprachigen Landen gibt es Vorläufer. Wer erinnert sich noch an den Schweizer „Kollegen“ Tom Kummer und seine Version von „Borderline-Journalismus“? Dessen Spezialität waren Interviews mit Hollywood-Stars wie Brad Pitt oder Sharon Stone. Der Haken: Kummer hatte diese Gespräche nie selbst geführt, sondern aus vorhandenem Material plagiiert oder schlicht erfunden. Sein Credo: „Fakten sind langweilig“. Ein anderes seiner Opfer war übrigens Ivana Trump (!), die erste Gattin des US-Despoten: Diese eher schlicht gestrickte Lady ließ er im gefakten Interview geradezu als Philosophin des amerikanischen Konservatismus erscheinen.
Ob Trumps Beraterin Kellyanne Conway und sein Ex-Sprecher Sean Spicer sich auch als Konzeptkünstler begreifen wie Tom Kummer, wissen wir nicht. Für den Journalistenberuf reicht allemal solides Handwerk. Reporter und Journalistinnen sollten sich bemühen, die Realität möglichst wahrheitsgemäß abzubilden. „Alternative Fakten“ dagegen gilt es als das zu enttarnen, was sie sind: Falschaussagen, Verschleierungen und bewusste Irreführung.