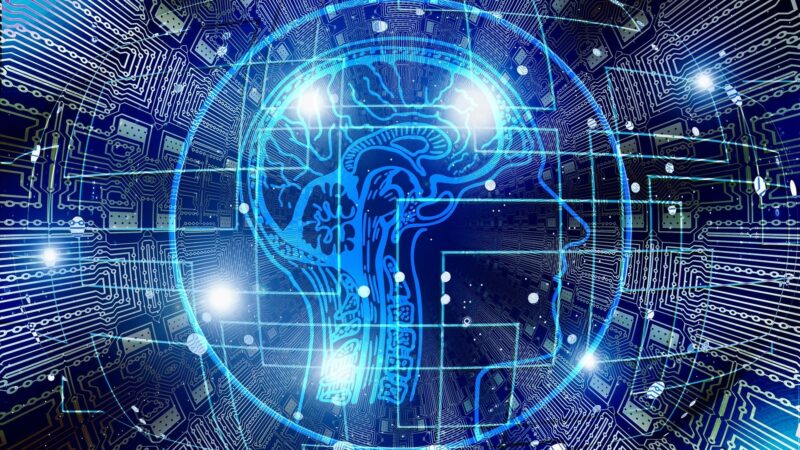Algorithmen können mit Hilfe von großen Datenmengen schon heute Videoclips oder Deepfakes erstellen. Von einem Dokumentarfilm erwarten die Zuschauer*innen aber vor allem eines: Authentizität. Der Dokumentarfilm, ob Dokusoap oder Tierfilm sind schließlich keine Fiktion, sondern Abbild der Realität. Zwar ist ein Dokumentarfilm keine Reportage, sondern ein künstlerisches Produkt. Es nutzt Original-Dokumente und fügt nachgestellte oder bearbeitete Szenen hinzu. Aber die Originaldokumente sollten als solche erkennbar bleiben. In Zeiten von KI steht dieser Anspruch neu zur Debatte.
Der Skandal um den NDR-Film „Lovemobil“, der in weiten Teilen inszeniert war, zeigte im Jahr 2021, dass das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit der Bilder leicht zu erschüttern ist. Lovemobil erzählt von Sexarbeiterinnen, die in ihrem Wohnwagen auf einem Parkplatz arbeiten. Die Frauen und die Freier wurden von Bekannten der Regisseurin gespielt. Transparent gemacht wird das nicht. Wo der Dokumentarfilm also nicht explizit die gestellten, bearbeiteten oder generierten Bilder kenntlich macht, läuft er Gefahr, für echt gehalten zu werden. Eine KI ist heute in der Lage, Bilder auch maschinell nachzustellen. Sie zu erkennen wird immer schwieriger.
Generative KI manipuliert Bilder
Der Bildanbieter Adobe verkauft beispielsweise KI-generierte Bilder, die den Krieg zwischen Israel und der Hamas darstellen. Sie zeigen Kriegsszenen, verwüstete Straßenzüge und sogar vermeintliche Opfer. Das Unternehmen verlangt zwar, dass die Künstler*innen alle KI-generierten Bilder auf der Plattform als solche kennzeichnen. Einige der zum Verkauf stehenden Bilder sind jedoch nur im Kleingedruckten als KI-generiert gekennzeichnet, nicht im Titel.
Die Frage, was im Dokumentarfilm machbar und was ethisch vertretbar ist, stellt sich also nicht neu. Durch den technischen Fortschritt verschiebt sich aber ihr Fokus. Schon heute erstellen KIs Storyboards oder transkribieren Dialoge. Neben den Fragen von Urheberschaft, Arbeitserleichterung oder Kostensenkung in der Produktion werden damit aber auch ethische Fragen neu diskutiert. Firmen wie Metaphysik haben sich auf hyperrealistischen Nachbildungen von Prominenten und Schauspieler*innen spezialisiert. Prof. Sylvia Rothe von der Hochschule für Fernsehen und Film in München sagte auf dem diesjährigen Internationalen Leipziger Festival für Dokumentarfilm, dass sogenannte Deep Fakes im Dokumentarfilm zum Beispiel auch genutzt werden könnten, um Protagonist*innen zu schützen – indem man ihnen ein anderes Gesicht gibt, das dann trotzdem die gleichen Gefühle transportiere.
Nutzen und Gefahr abwägen
Im Idealfall kann eine KI also lästige Fleißarbeiten übernehmen, während den Filmemacher*innen mehr Zeit für Recherche und Kreativität bleibt. Wie in jeder anderen Branche hängt die Gefahr der KI für die Kreativen, die Produzierenden, die Beschäftigten jedoch davon ab, welche Arbeiten sie übernimmt und wie darüber entschieden wird. Denn ohne Mitbestimmung und Transparenz können persönliche und kollektive Rechte nicht ausreichend geschützt werde.
Mehr zum Thema KI in den Medien