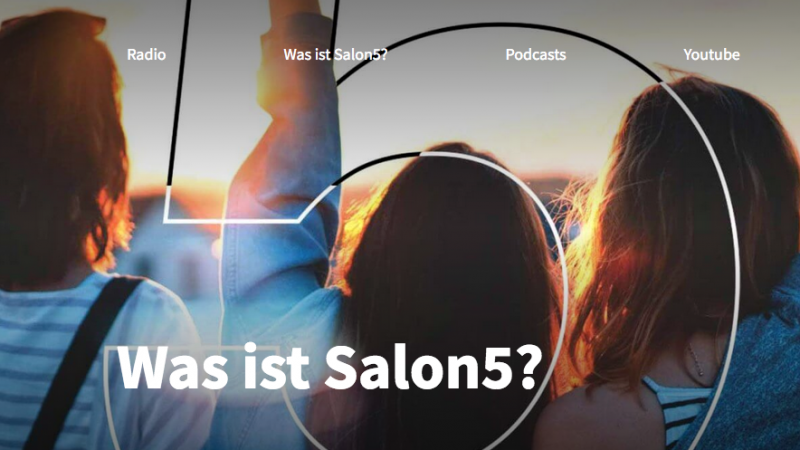Auch für die unter Dreißigjährigen der Generation Z bleibt Journalismus attraktiv, doch viele fühlen sich nicht angesprochen: Ihre Themen fehlen und der Medienberuf birgt viele Unsicherheiten. Lokalredaktionen könnten Pionierarbeit leisten, indem sie jünger, digitaler, diverser und thematisch weiter ganz nah dran sind. Wie das geht, demonstrierte am 30. Mai eine Online-Fachtagung der Neuen deutschen Medienmacher*innen.
Da gibt es zum Beispiel die Jugendredaktion “Salon 5” des Recherchenetzwerks Correctiv, die Redaktionsleiterin Hatice Kahraman vorstellte. Das Podcast-Projekt startete sie gleich zu Beginn ihres Volontariats im März 2020 zusammen mit Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren – „als klassische Lokalredaktion“. Sie machen 24 Stunden Radio, sind auf Instagram, TikTok und YouTube präsent mit „Themen, die sie interessieren“: Musik, Bücher, Klima, Familie, Schule, Freundschaft oder Selbstfindung. Die Jugendlichen bekommen eine kurze Einarbeitung und entscheiden selbst über die Themen, die sie dann mit dem 12köpfigen Team „auf Augenhöhe“ bearbeiten.
„Wenn wir fragen ‚Wie geht es dir?‘, dann öffnen sie sich für ihre Lebenswelt und nennen bei der Themensuche nicht Allgemeines, etwa aus der Tagesschau“, so Hatice Kahraman. Erst müsse man außerhalb von Schulkosmos und Elternhaus „einen Ort schaffen, wo junge Menschen sich austauschen können, dann kommen die Themen!“. Die Redaktion ist in einem ehemaligen Ladenlokal in Bottrop untergebracht. Inzwischen gibt es zwei weitere Jugendredaktionen „Salon 5“, benannt nach Artikel 5 des Grundgesetzes. In Greifswald steht das Thema Klima im Fokus und in Hamburg-Bergedorf finden Jugendliche abseits des Zentrums einen Begegnungsort. Alle Jugendredaktionen sind stiftungsfinanziert.
„Themen herunterbrechen auf die Lebenswelt der Jugendlichen vor Ort – das geht“, ist Redaktionsleiterin Kahraman überzeugt. „Krass, voll das interessante Thema“ kommentierte etwa ein Jugendlicher die Correctiv-Recherche zu Steuerbetrug auf dem Immobilienmarkt, als er erfuhr, was das für sein Zimmer, die elterliche Wohnung bedeutet. Zur Landtagswahl publizierte das Team einen Guide, befragte Landtagskandidat*innen oder wertete die Klimapolitik der Parteien aus. In der Audio-Doku „Bottroper Protokolle II“ sprachen die Jugendlichen mit Menschen aus der Ruhrgebietsstadt, die nicht studiert haben, die keine Stimme haben – über ihre Arbeit, ihr Leben, Heimatgefühle, Sorgen und Träume.
Gegen Ängste und Erklärungsnot
In der Folge ging es darum, wie die deutsche Medienlandschaft diverser werden kann. Es wurden zunächst drei Gründe genannt, warum sich Menschen mit interkulturellem Background häufig von Lokalredaktionen nicht angesprochen fühlen. Da sei zunächst die „Angst, als anstrengend wahrgenommen zu werden“ – etwa wenn sie Diskriminierungserfahrungen ansprechen. Ein junger Journalist aus Leipzig befürchtete zum Beispiel, dass er ins tiefste Sachsen geschickt wird. Einige erleben in der Redaktion „einen Kulturschock“, wenn ihnen Fragen gestellt wurden, bei denen sie sich nicht wohl fühlten. Andere beklagen fehlende Unterstützung. Selbst kompetenten Leuten im Personalrat oder Gleichstellungsbeauftragten müssten sie „erstmal erklären, was Diskriminierung ist“.
Als notwendige Veränderungen wünschten sich viele „Verbündete in den Redaktionen“, „gezielte Förderung“, etwa durch Mentor*innen und „bessere Arbeitsbedingungen“, d. h. langfristige Verträge, angemessen bezahlte Praktika und Stipendien. Auch die Redaktionskultur müsse sich ändern. Es reiche nicht, Vielfalt nach außen zu demonstrieren. So sollten etwa Anti-Rassismus-Workshops verpflichtend sein, da sonst diejenigen, die es bräuchten, nicht teilnehmen.
Als ein Knackpunkt für den Einstieg in den Journalismus kristallisierten sich auch soziale Hürden heraus. Etwa das Studium, das lange Zeit – insbesondere für ein Rundfunkvolontariat – vorausgesetzt wurde oder Praktika, die viele Verlagshäuser nicht bezahlen. Benachteiligt sind so junge Menschen ohne Studium und die aus ärmeren Familien. Sie müssen sich verschulden oder nebenher jobben, um Redaktionsluft zu schnuppern.
Auch unangenehme Sachen sagen
Nicht studiert hat Isabell Beer, die im Rechercheteam von „funk“ arbeitet, dem ARD/ZDF-Content-Netzwerk für junge Menschen. Rückblickend auf ihre zehnjährige journalistische Tätigkeit erzählte sie: „Ich habe mich lange Zeit angepasst.“ Wenn sie in der ZEIT-Redaktion Fremdwörter nicht verstand, habe sie gegoogelt, jetzt frage sie: „Kannst du mir das mal erklären?“ Man müsse eingefahrene Strukturen aufbrechen, nicht danach streben, von allen gemocht zu werden, sondern auch „Sachen sagen, die unangenehm sind!“
Dass eine solche selbstbewusste Haltung auch in Lokalredaktionen erfolgreich sein kann, zeigte NdM-Vorstandsmitglied Ella Schindler, die Volontariatsbeauftrage im Verlag Nürnberger Presse ist, an einem Beispiel: „Eine diverskulturelle Volontärin in einer Außenredaktion“ habe in einem Artikel „Schwarze Menschen“ groß geschrieben. Als der Redaktionsleiter das mit Verweis auf Unverständnis seitens der Leserschaft ändern wollte, wandte sie sich an Schindler und die Chefredaktion, die dann entschied: Selbstverständlich könne sie die Schreibweise beibehalten, allerdings solle die politische Bedeutung des Begriffs in einer Passage erklärt werden.