Über gendersensible Sprache läuft schon seit Jahren eine hochemotionale Debatte. In Bayerns Schulen, Hochschulen und Behörden gilt seit dem 1. April sogar ein Genderverbot. Über Begrifflichkeiten wie „steigende Preise“ oder Finanzkrisen, die wie ein „Tsunami“ über uns kommen, wird dagegen weniger gestritten. Sie beherrschen längst unser Denken und Sprechen, sind in unseren Alltag eingedrungen. Wer in diesem Wirtschaftssystem sozialisiert wurde, nutzt sie automatisch, ohne weiter darüber nachzudenken.
Dabei lohnt es sich, solche Begriffe auf ihren ideologischen Gehalt abzuklopfen, meinen die Autoren des soeben erschienen Bandes. Als „Sprache des Kapitalismus“ definieren sie „bestimmte Sprachbilder und Metaphern, Redewendungen und Phrasen, Mythen und Erzählungen sowie einzelne Begriffe, mit denen ökonomische Zusammenhänge beschrieben und erzählt werden“. Das geht los bei simplen Bildern wie den Preissteigerungen. Zuletzt „explodierten“ die Preise sogar. Preise „steigen“ aber nicht einfach, sie werden „erhöht“, von Unternehmen oder Dienstleistern.
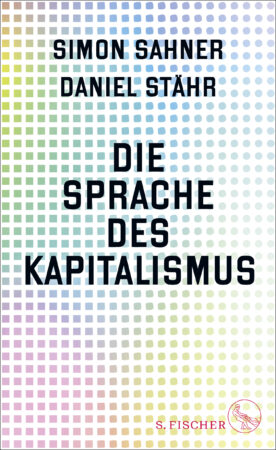 Besonders gern verwenden Ökonomen und Wirtschaftsjournalist*innen Naturkatastrophen-Metaphern. Die Finanzkrise nimmt dann den Charakter eines „Hurrican“ oder eines „Tsunamis“ an. Damit wird der Eindruck erweckt, der Kapitalismus funktioniere nach Naturgesetzen, mit unvermeidbaren Folgen. Wer das schluckt, setzt sich nicht weiter damit auseinander, denkt gar nicht erst über mögliche Alternativen und Handlungsmöglichkeiten nach. Insofern hat diese Sprache systemstabilisierende Wirkung, finden Ökonom Stahr und Literaturwissenschaftler Sahner.
Besonders gern verwenden Ökonomen und Wirtschaftsjournalist*innen Naturkatastrophen-Metaphern. Die Finanzkrise nimmt dann den Charakter eines „Hurrican“ oder eines „Tsunamis“ an. Damit wird der Eindruck erweckt, der Kapitalismus funktioniere nach Naturgesetzen, mit unvermeidbaren Folgen. Wer das schluckt, setzt sich nicht weiter damit auseinander, denkt gar nicht erst über mögliche Alternativen und Handlungsmöglichkeiten nach. Insofern hat diese Sprache systemstabilisierende Wirkung, finden Ökonom Stahr und Literaturwissenschaftler Sahner.
Sicher: Wirtschaftliche Vorgänge sind häufig sehr abstrakt. Metaphern sollen helfen, komplexe Abläufe so zu verpacken, dass sie vermeintlich leichter verständlich werden. Gerade noch „Exportweltmeister“ verwandelt sich Deutschland in den „kranken Mann“ (!) Europas. Ein besonders wirkmächtiges Bild ist das des „Marktes“. Der führt offenbar ein Eigenleben: Man muss ihn „beruhigen“, ist seinen Launen mehr oder weniger „ausgeliefert“. Ein Umstand, den Stuttgarter Bosch-Kolleg*innen kürzlich bei einer Demonstration der IG Metall gegen geplante Entlassungen auf einem Transparent drastisch kommentierten: „Der Markt hat nur Scheiße im Kopf“.
Dem Markt ergeben
Börsenberichte klingen oft so marktergeben, als existiere dieser Markt außerhalb des Staates, monieren die Autoren. Das aber sei „gefährlich, weil wir als Gesellschaft unsere Handlungsmöglichkeiten beschneiden“. Schließlich lasse sich – demokratische Mehrheiten vorausgesetzt – die marktwirtschaftliche Grundordnung ändern.
Das Buch liefert auch nützliche Einordnungen aktueller sprachlicher Entgleisungen marktfixierter Politiker*innen. Von der „spätrömischen Dekadenz“, die der damalige FDP-Vizekanzler Guido Westerwelle 2010 im Kontext einer Erhöhung der Hartz-IV-Sätze witterte, über die „Gratismentalität“-Sprüche seines Parteikollegen Christian Lindner bis zur aktuellen „Fordern-und-Fördern“-Keule im Rahmen der heutigen Bürgergeld-Debatte. Sinnbilder dafür, wie Armut in der Sprache des Kapitalismus markiert wird. Das Credo der Autoren: „Wenn wir unsere Sprache reflektieren, ist es der erste Schritt, um ein besseres System zu gestalten.“
Simon Sahner/Daniel Stähr: Die Sprache des Kapitalismus. S.Fischer Verlag, Frankfurt/M. 2024. 300 Seiten, 24 Euro.



