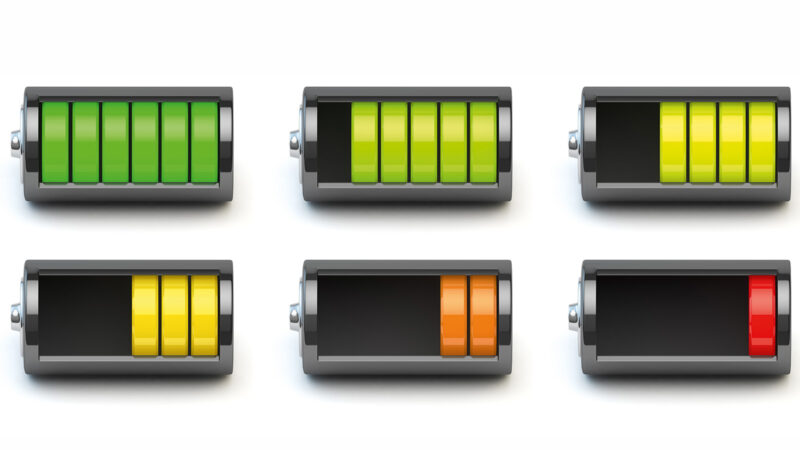Auf die mentale Gesundheit zu achten, ist keine individuelle Aufgabe. Auch Arbeitgeber*innen können und sollten etwas für psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter*innen tun. Wie funktioniert das in einer Branche, die so geprägt ist von Zeit und Leistungsdruck und belastenden Inhalten wie der Journalismus? Wir haben uns in zwei Redaktionen umgehört, die sich dazu Gedanken gemacht haben: das Magazin Neue Narrative und der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ).
Das mit dem leeren Akku nimmt man bei Neue Narrative recht genau. Die Redaktion hat kein festes Büro, die Mitarbeiter*innen leben und arbeiten an unterschiedlichen Orten. Darum organisiert sich das Team digital, die Kommunikation läuft über einen Online-Chat. Fühlt sich jemand mal nicht ganz auf der Höhe, kann er oder sie das mit dem Symbol eines fast leeren Akkus zeigen. So wissen die Kolleg*innen, dass diese Person an dem Tag nicht ganz belastbar ist – ohne dass sie sich erklären muss. Emma Marx, Redakteurin und Regenerative Lead bei Neue Narrative, erzählt im Gespräch von dieser internen Abmachung. Sie sagt viel aus über die Arbeitskultur einer Redaktion, die New Work nicht nur zum Schwerpunkt ihres Magazins gemacht hat, sondern auch täglich zu leben versucht.
Der Gesundheit am Arbeitsplatz haben Emma und ihre Kolleg*innen schon ein ganzes Heft gewidmet. „Gesundheit, und dazu gehört auch psychische Gesundheit, ist die Grundlage. Wenn man nicht gesund ist, kann man nicht arbeiten“, sagt Marx. Jeder Artikel, der für das Magazin entsteht, durchläuft einen strukturierten Prozess, dessen einzelne Schritte genau festgelegt sind. In jeder Phase steht den Schreibenden eine Kollegin oder ein Kollege zur Seite. Auch sie habe schon mal bis spätabends frustriert über einem Text gesessen, sagt Marx. Doch größtenteils helfe dieser klare Ablauf, Unsicherheiten und Stress zu vermeiden. Allerdings gilt dabei zu bedenken: Das Heft erscheint nur dreimal im Jahr – ein anderer Takt als etwa bei einer Tageszeitung. Eine Chefredaktion gibt es bei Neue Narrative übrigens nicht.
Die Pandemie als Wendepunkt
Für den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag sei die Corona-Pandemie ein Wendepunkt gewesen, sagt Gerrit Bastian Mathiesen. Er ist einer von vier Chefredakteur*innen des SHZ und zuständig für Personal und Finanzen. Zum Verlag gehören 22 Tageszeitungen im Land. Die Pandemie sei eine fordernde Zeit gewesen, mit intensiven Recherchen. Psychische Gesundheit sei in der Öffentlichkeit zunehmend ein Thema geworden, das habe sich auf die Redaktion ausgewirkt. „Journalistinnen und Journalisten waren schon immer hohen psychischen Belastungen ausgesetzt“, sagt Mathiesen. „Aber Jahrzehnte wurde nicht darüber gesprochen.“ Während der Pandemie hat der SHZ einen Sozialberater angestellt, an den sich die 190 Redaktionsmitglieder wenden können. Der könne dann Kontakte zu Ärzten oder Therapeuten herstellen, aber auch das Gespräch mit den Vorgesetzten suchen und die Anliegen der jeweiligen Person vertreten.
Vorgesetzte, sagt Mathiesen, seien angehalten, die Mitarbeitenden im Blick zu haben und hin und wieder zu fragen: „Wie geht’s dir?“ Sowohl Marx als auch Mathiesen betonen, wie wichtig Gespräche sind. Beim SHZ gebe es seit ein paar Jahren einmal jährlich ein Mitarbeitergespräch, das ausdrücklich konstruktiv geführt werde und bei dem die Mitarbeitenden im Mittelpunkt stehen. Das habe die Bindung zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten deutlich gestärkt. Ähnliche Gespräche gibt es auch bei Neue Narrative, allerdings finden die deutlich öfter, etwa einmal im Monat, statt. Hier stehe die persönliche und berufliche Entwicklung im Vordergrund, auch unabhängig von den aktuellen Aufgaben.
Journalismus ohne Überstunden ist nicht denkbar – diese Ansicht vertreten nach wie vor viele in der Branche. Auch bei NN und dem SHZ geht es nicht ganz ohne. Marx etwa hat eine individuelle Lösung gefunden: Sie arbeitet mehr, wenn viel zu tun ist, und weniger, wenn es ruhig ist. Ziel beim SHZ sei es, dass Mitarbeiter*innen ihre Überstunden möglichst direkt ausgleichen können, sagt Mathiesen. Es sei Aufgabe der Vorgesetzten, ein Auge darauf zu haben, dass die Mitarbeitenden nicht zu viele Überstunden machen.
„Genug Personal ist die wichtigste Mental-Health-Strategie“
In beiden Redaktionen seien diverse Arbeitszeitmodelle möglich. Und es gibt eine weitere Gemeinsamkeit: Beide Redaktionen haben transparente Gehälter. „Ich weiß von all meinen Kolleg*innen, was sie verdienen, und wir haben Gehaltsprozesse, in denen wir das gemeinsam aushandeln“, sagt Marx. Mathiesen verweist darauf, dass die hauseigene Vergütungsordnung der SHZ intern für alle einsehbar sei.
Kritik am Verlag kam im vergangenen Jahr von einer Gruppe, die nicht auf die Unterstützung eines Arbeitgebers vertrauen kann: den Freiberuflern. Der Verband Freischreiber nominierte Mathiesen im vergangenen Jahr für einen Negativpreis. Als Gründe nannte der Verband „herablassende Äußerungen Freien gegenüber“ und die Weitergabe von Beiträgen von Freien an weitere Zeitungen außerhalb Schleswig-Holsteins „ohne die Freien darüber zu informieren, geschweige denn dafür zu bezahlen“. Mathiesen betonte im Gespräch mit M, dass die Arbeit von Freien ein wichtiger Pfeiler des SHZ sei. Wenn der Verlag Beiträge auch anderen Zeitungen anbiete, schlage sich das im Honorar für die Freien nieder, sagte er.
Marx verweist selbstkritisch darauf, dass auch bei einem progressiven Arbeitgeber wie NN nicht alles gut läuft. Im vergangenen Jahr steckte das Magazin in einer Krise. Man sei zu schnell gewachsen, habe Mitarbeiter*innen entlassen müssen, mit dem Resultat, dass man nun an manchen Stellen unterbesetzt sei. „Wir erholen uns immer noch davon“, sagt sie. Auch dabei setzt das Team auf Gespräche und möglichst viel Transparenz. Die eine Maßnahme, mit der man die psychische Gesundheit der Mitarbeiter*innen stärkt, gebe es wohl nicht, sagt Marx. Es seien mehrere Teile, die zusammen ein gutes Arbeitsumfeld ausmachen. Aber: „Genug Personal ist, glaube ich, die wichtigste Mental-Health-Strategie.“
Der Schutzkodex Hilfe für bedrohte Journalist*innen
Den Schutzkodex
… gibt es seit 2022, er ist eine Initiative der dju in ver.di, Reporter ohne Grenzen, der Neuen deutschen Medienmacher*innen und der VBRG (Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt).
Der Schutzkodex sieht Standards für Medienhäuser vor sowie konkrete Maßnahmen, um festangestellte und freiberufliche Journalist*innen zu unterstützen. Dazu gehören feste Ansprechpersonen, psychologische und juristische Unterstützung sowie Hilfe für den Fall, dass ein Wechsel der Wohnung nötig wird. Einige Medienhäuser setzen den Kodex bereits um, darunter der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung, Funke und der Weser-Kurier.
- Ansprechperson für Bedrohungen und Angriffe
- Ansprechperson für Hassmails
- Psychologische Unterstützung
- Juristische Unterstützung
- Gewährleistung von Personenschutz
- Unterstützung bei Wohnungswechseln
- Sperrung von Nutzer*innen
- Social Media Watch
- Kostenübernahme
- Weiterbildungen