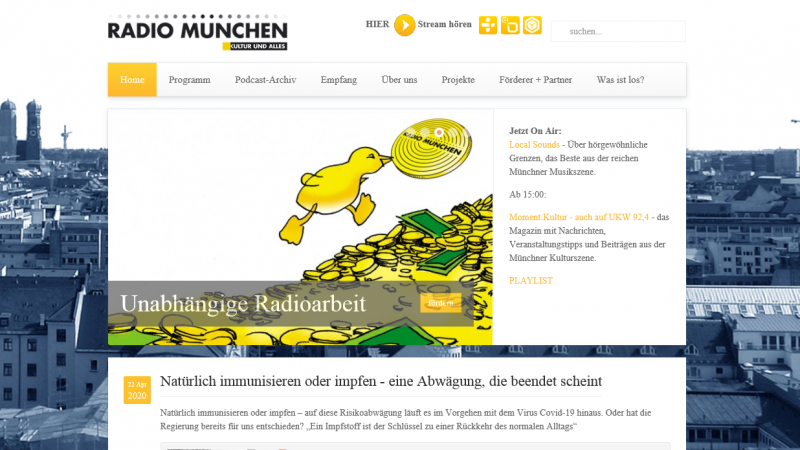In Ungarn kann derzeit die „Verbreitung falscher oder verzerrter Behauptungen über die Tätigkeit der Regierung“ mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Davon kann in Bayern keine Rede sein, aber eine gewisse Bereitschaft, die Berichterstattung über dissidente Meinungen zu maßregeln, findet sich auch hier. So hat die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) den Lokalsender Radio München gerügt, die „journalistische Sorgfaltspflicht“ vernachlässigt zu haben. Stein des Anstoßes ist ein Interview mit dem umstrittenen Corona-Kritiker Wolfgang Wodarg.
Radio München ist ein Lokalsender, der nicht jedem Münchner geläufig ist, denn sein Programm findet vorwiegend im Internet und auf digitaler Welle (DAB) statt. Und werktags von 15. bis 16.00 Uhr eine Stunde lang auf der UKW-Frequenz 92,4. Dort tummeln sich sechs verschiedene Sender, bis 15 Uhr ist zum Beispiel ein Kirchenradio zu hören. Vielleicht sind am Donnerstag, den 26. März, einige der Hörer auch nach 15 Uhr hängengeblieben und hatten das Interview der Medizinjournalistin Eva Schmidt mit dem Mediziner Wolfgang Wodarg gehört. Jedenfalls berichtet das BLM von mehreren Beschwerden über dieses Interview.
Es beginnt mit einem Statement des Arztes, dass es ihm angesichts des Presseechos auf seine Thesen und die damit verbundenen Anfeindungen nicht wirklich gut gehe. Denn Wodarg war einer der ersten, die sich kritisch zur Art und Weise geäußert hatten, wie die Bundesregierung das Corona-Virus bekämpft. Seiner Meinung nach sind die getroffenen Maßnahmen überzogen und das ist die Meinung eines Mannes, dem es als Lungenfacharzt und ehemaligen Leiter eines Gesundheitsamtes nicht an Expertise fehlt. Die Reaktionen auf seine Kritik war heftig, so schloss Transparency Deutschland ihn vorerst aus dem Vorstand aus, dem er bisher angehört hatte.
Wodarg begründet seine kritische Meinung und steht damit im Feld einer wissenschaftlichen Diskussion, die keineswegs homogen ist. Die BLM allerdings scheint weniger die Diskussion als die Orthodoxie – also die Rechtgläubigkeit – im Sinn zu haben. Jedenfalls bekam der Sender Radio München am 6. April ein Schreiben, in dem die BLM die „journalistische Sorgfaltspflicht“ anmahnte. Begründet wurde diese Einschätzung mit der Auswahl der Interviewpartner (es gab noch mehrere), die „als kritisch gegenüber den aktuellen Entscheidungen der Bunderegierung aufgefasst werden kann“. Zwar sei dies eine eigenverantwortliche redaktionelle Entscheidung, allerdings sei „gerade bei medizinischen Themen die journalistische Sorgfaltspflicht besonders zu beachten“, Informationen aus dem medizinischen Bereich müssten „mit besonderer journalistischer Sensibilität“ behandelt werden. Auch die Interviewführung sei zu bemängeln, so die BLM, da „es weder kritische Nachfragen enthält, noch die Aussagen des Gastes deutlich in den aktuellen wissenschaftlichen Kontext einordnet.“
Für die Journalistin Eva Schmidt ist die Rüge nicht nachvollziehbar, sie empfindet die Anweisungen der BLM als „eine Einschränkung“, das Schreiben als „bedenklich“ im Sinne der Pressefreiheit. Da die BLM in einem Schlusssatz fordert, dass „derartige problematische Sendungen zukünftig ausbleiben“ sollten, schrieb sie an die Aufsichtsbehörde zurück: „Um zukünftig treffsicher unterscheiden zu können, welche Sendungen ausbleiben müssen, bitte ich um die Nennung klarer Unterscheidungskriterien.“ Eine Antwort blieb bisher aus.
Professor Michael Meyen vom Kommunikationswissenschaftlichen Institut der Universität München kommt hinsichtlich des beanstandeten Interviews (das auf der Homepage des Senders nachzuhören ist) zu einem völlig anderen Schluß als die BLM. Bei der journalistischen Sorgfaltspflicht gehe es ja um zwei Dinge: „Zum einen sollen wir als Rezipienten sicher sein, dass das, was uns Medien anbieten, von der Redaktion geprüft wurde. Woher kommt die Information, in welchem Verhältnis steht sie zur Wirklichkeit und vielleicht auch: wem könnte das nutzen?“ Zum anderen ziele der Begriff auf die Rechte anderer: „Bin ich mir als Redaktion sicher, dass das Interesse der Öffentlichkeit größer ist als der Schaden, den zum Beispiel Menschen erfahren, über die berichtet wird?“ Beide Dinge seien bei Interviews aber eigentlich kein Problem: „Die Quelle ist klar, es handelt sich um Aussagen einer konkreten Person, und wenn Dritte Schaden nehmen sollten, ist dafür zunächst einmal derjenige haftbar zu machen, der dort spricht.“ Insofern sei die Sorgfaltspflicht kein Qualitätskriterium, mit dem man die beanstandeten Interviews von Radio München messen sollte. Das Fazit des Professors: „Ich sehe die Sache so. Durch die Auswahl von Interviewpartnern, die etwas zu sagen haben, aber im Diskurs der Leitmedien kaum zu Wort kommen, leistet das Programm hier einen Beitrag zur publizistischen Vielfalt, und sollte folglich von der BLM gelobt werden.“