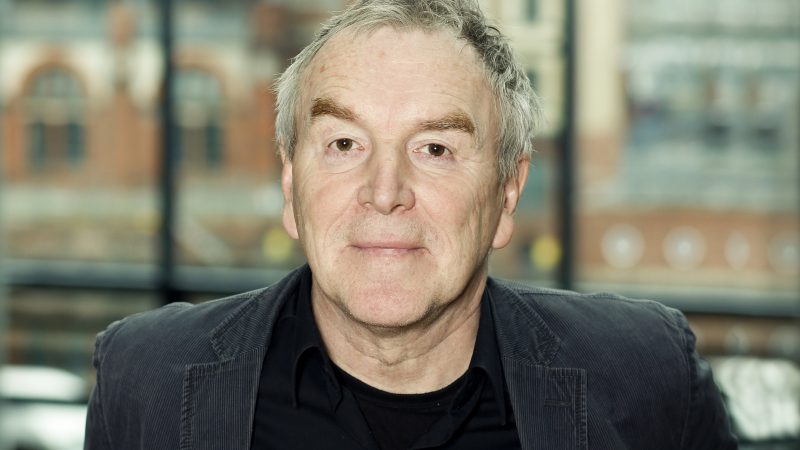Meinung
Vor allem der brandenburgische Partner der Zwei-Länder-Anstalt hatte es offenbar darauf angelegt, den Sender nach der skandalösen Amtsführung der im August 2022 gefeuerten Intendantin Patricia Schlesinger zu disziplinieren. Und zugleich die Gelegenheit zu nutzen, durch einschneidende Auflagen die Sichtbarkeit des Flächenlandes im Programm deutlich zu steigern: durch ein neues Regionalbüro in Brandenburg an der Havel, durch eine Verdoppelung des regional auseinandergeschalteten TV-Programms von 30 auf 60 Minuten, durch zwei vom Rundfunkrat zu wählende Leiter*innen für die Landesangebote.
Eingriff in die Programmautonomie
Sowohl die Intendanz als auch die Belegschaft bewerteten diese neuen Vorschriften zu Recht als Eingriff in die Programmautonomie. Mehr Regionalprogramm klingt zunächst gut, ist aber nach Schätzung von Intendantin Demmer mit Mehrkosten von rund drei Millionen Euro verbunden. Dabei muss der klamme Sender bis Ende 2024 den in der Ära Schlesinger akkumulierten Schuldenberg von 49 Millionen Euro abtragen, unter anderem durch Streichung von 100 Stellen. Wie bei der ebenfalls beschlossenen Begrenzung der Werbezeiten im Radio nun auch noch zusätzlich lineares TV-Programm finanziert werden soll, bleibt das Geheimnis der schwarz-rot-grünen Regierungskoalitionäre.
Gegen Demmers Widerstand
Unberücksichtigt blieb auch der Einwand Demmers, sie würde lieber in die Zukunft investieren, in digitale Programme, in mehr Qualitätsjournalismus als in zusätzliche Büroräume. Wenn das Geld nicht ausreiche, habe der RBB eben „nicht ein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem“ – diese schnippische Replik des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ist an Arroganz kaum zu übertreffen. Was ist das Bekenntnis zu einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich wert, wenn beide Landesväter zugleich schon seit Monaten Stimmung gegen jede Erhöhung des Rundfunkbeitrags machen?
Gehaltsdeckel für die RBB-Spitze
Natürlich enthält der Staatsvertrag auch Positives. Zum Beispiel den künftigen Gehaltsdeckel für die RBB-Spitze, die weit reichenden Regeln für eine bessere Kontrolle des Senders durch Professionalisierung der Gremien und die Erweiterung der Transparenzregelungen. Aus gewerkschaftlicher Sicht begrüßenswert ist die Einbeziehung arbeitnehmerähnlicher Mitarbeiter*innen in die Mitbestimmung des Personalrates. Wobei ver.di sich darüber hinaus eine stärkere Beteiligung der Mitarbeitenden in den Aufsichtsgremien gewünscht hätte.
Nun muss das Paragrafenwerk noch von den beiden Landesparlamenten verabschiedet werden, was aber als Formsache gilt. Anfang 2024 könnte der Staatvertrag in Kraft treten. Erst im nächsten Frühjahr will die RBB-Intendanz ihr „Zielbild 2028“ für einen „schlankeren und beweglicheren Sender“ vorlegen. Möglicherweise nur ein Euphemismus für „Sparen, bis es quietscht“.