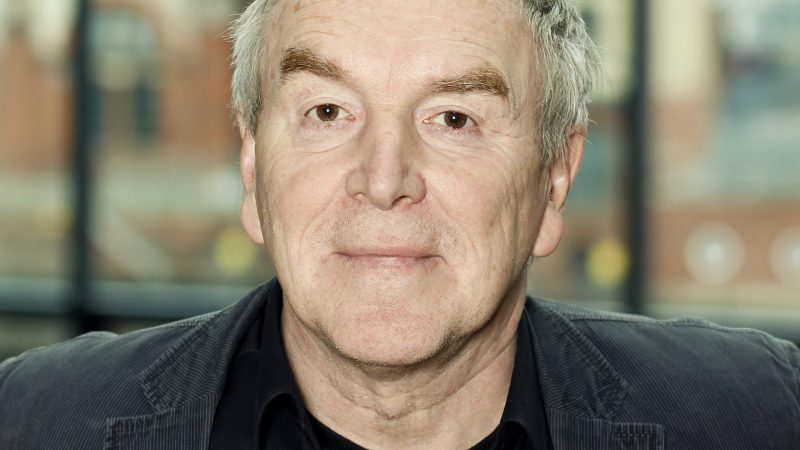Meinung
Aufgrund von Döpfners Rolle als Vorstandschef, Verleger und zeitweiliger BDZV-Präsident besteht selbstverständlich ein starkes öffentliches Interesse an seiner in diesen Chats enthüllten Denke und seinem kruden Weltbild. Das gilt erst recht für die Nachrichten, die Döpfner an leitende Mitarbeiter der „Bild“ schickte, in denen er die Redaktion aufforderte, sie sollten zusehen, dass man die FDP so stark wie möglich mache: „Please stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten dass die platzt“, schrieb Döpfner zwei Tage vor der Bundestagswahl an den später in Ungnade gefallenen „Bild“-Chef Julian Reichelt. Dieser klare Versuch einer (geglückten) Einmischung in die Wahlberichterstattung, so der Presserat, stehe in klarem Widerspruch zum hauseigenen „Code of Conduct“ und der darin geforderten redaktionellen Unabhängigkeit von der Geschäftsleitung. Wenn ein Chef seinem Angestellten eine politische Richtung vorgibt, ist das alles andere als privat. Umso größer das Verdienst der „Zeit“, die derlei Machenschaft publik gemacht hat.
Zum Ethos des Journalismus gehört unbedingt auch der Informantenschutz, festgehalten in Ziffer 5 des Pressekodex. Holger Friedrich, Verleger der „Berliner Zeitung“, hält diese Richtlinie offenbar für vernachlässigbar. Anders lässt sich kaum erklären, dass er seinen Informanten, den Ex-„Bild“-Chef Julian Reichelt, an den Springer-Verlag verpetzte. Reichelt hatte ihm mutmaßlich eben die Whatsapp-Ergüsse Döpfners zugespielt, die später von der „Zeit“ des Holtzbrinck-Konzerns sehr öffentlichkeitswirksam publiziert wurden. Immerhin: Die Redaktion der „Berliner Zeitung“ verhielt sich – im Gegensatz zum eigenen Verleger – korrekt, indem sie den Informantenschutz respektierte, wiewohl sie von einer Veröffentlichung der Geschichte absah. Friedrich hatte übrigens seinen Tabubruch mit der hanebüchenen Begründung verteidigt, er wolle damit eine Debatte über ethische Standards und journalistische Verantwortung anstoßen. Was die „Süddeutsche Zeitung“ zu dem sarkastischen Kommentar veranlasste, das sei ein wenig, „als laufe man mit einem Revolver in die Schule, weil man über Schulschießereien debattieren möchte“. Die Ohrfeige, die der Presserat dem umstrittenen Verleger in Form einer Rüge verpasste, ist somit mehr als berechtigt.
Aber auch der lobenswerte Quellenschutz, den die Redaktion der „Berliner Zeitung“ in Sachen Döpfner-Leaks praktizierte, ist nicht ganz widerspruchsfrei. Ihr Chefreporter Jesko zu Dohna prangerte zugleich die „Zeit“-Enthüllung in einem wütenden Kommentar als „Voyeurismus pur“, als verwerfliche „Veröffentlichung von aus dem Zusammenhand gerissenen WhatsApp-Nachrichten“. Damit habe „der ehrwürdige und sonst so gutmenschliche Zeit Verlag…der Bild-Zeitung den Rang abgelaufen“. Das dürfte auch Dohnas Chef Friedrich, der sich mit seinem Blatt seit Jahren einen kleinen Pressekrieg mit dem „House of Holtzbrinck“ liefert, gefallen haben.