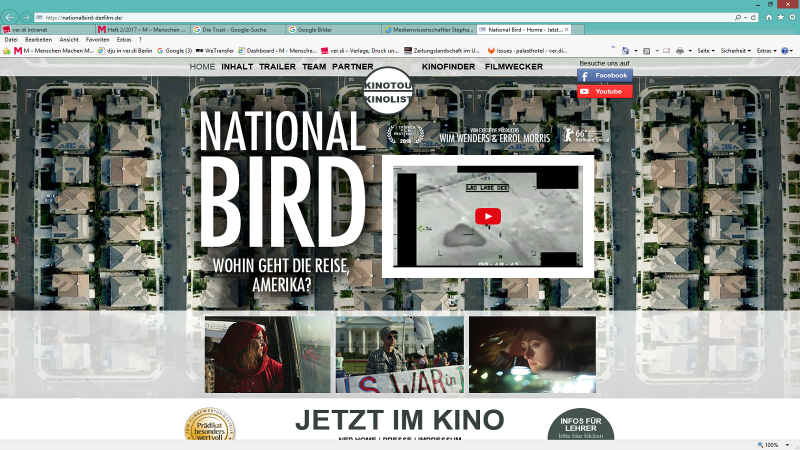Über den Zusammenhang zwischen Joystick und Beinprothese
„National Bird“ erzählt von den Folgen des Drohnenkriegs. Da sind die Menschen, die die Drohnen bedienen, die Ziele identifizieren, die von weit weg auf einen Knopf drücken oder auch nur die Bilder interpretieren. Was macht diese Tötungsarbeit, die wie ein Videospiel aussieht, mit den Menschen? Und da sind die unmittelbaren Opfer des Drohnenkriegs in Afghanistan, denen der Tod plötzlich und wortwörtlich von oben auf den Kopf fällt.
Dialogfetzen:
– Da ist mindestens ein Kind dabei. – Bullshit – Das mit dem Kind bezweifle ich. – Wie alt sind die Kinder? – Auch Teenager können kämpfen. – Was ist der Masterplan? – Hoffentlich dürfen wir den Truck mit all den Typen abschießen. – Sie rennen nicht weg. Das ist komisch. – Die Frau trägt ein Kind. – Nein. – Äh, ja. Ein Baby.
Das sind protokollierte Sätze aus dem Funkverkehr einer Hubschrauberbesatzung in Afghanistan mit Männern, die über eine Drohne die Leute auf dem Boden beobachten. Am Ende sind 21 Menschen tot, friedliche Reisende, die in drei Trucks unterwegs waren, Kinder und Frauen darunter.
Diese Szene ist eine der Schlüsselszenen des Films „National Bird“, der vom Drohnenkrieg der USA handelt. Regisseurin Sonia Kennebeck hat diese Szene visuell rekonstruiert, der Funkverkehr ist original. Er zeigt vor allem, dass Behauptungen über die Drohnenangriffe falsch sind. Sie treffen nicht nur einzelne. Und sie treffen Zivilisten. Aus mehreren tausend Kilometern Entfernung kann man nur schwer unterscheiden, ob auch Frauen und Kinder unter den Zielpersonen sind. Der Drohnenkrieg, unter Präsident Obama stark ausgeweitet, ist kein „sauberer Krieg“.
Für die Akteure des Drohnenkriegs stehen drei Protagonisten in diesem Film, die sich kritisch gegen den Krieg wenden und die selbst davon schwer beschädigt sind. Alle drei sind an die Öffentlichkeit gegangen, haben sich als Whistleblower angreifbar gemacht. Heather Linebaugh kritisiert die Verantwortungslosigkeit in der Befehlskette. Es macht sie kaputt, dass sie nicht weiß, am Tod wie vieler Menschen sie beteiligt war. Sie kämpft darum, mit dem Posttraumatischen Belastungssyndrom als schwerbeschädigt anerkannt zu werden und erreicht das auch in Kalifornien.
Auch Lisa Ling war als Technical Sergeant am Bildschirm an Operationen beteiligt, als Bildanalystin. Sie hat nie auf den Knopf gedrückt. Eines Tages reist sie nach Afghanistan, um mit eigenen Augen zu sehen, was bis dahin nur schwarze Punkte auf der Drohnenkamera waren: die Menschen, ihre Leiden, ihr Leben. Sie sei, sagt sie, beteiligt gewesen an 121.000 Aktionen „gegen aufständische Ziele“. Das sagt etwas über die Dimensionen des Drohnenkriegs.
Daniel arbeitete für mehrere Geheimdienste, ist jetzt politischer Aktivist. Sein Motiv, an die Öffentlichkeit zu gehen, ist die Intransparenz dieses Drohnenkriegs, das Verschweigen, das öffentliche Lügen darüber. Er drückt sich oft nur sehr vorsichtig und schwammig aus. Er hat Angst, über ihm schwebt die Drohung, von der Regierung nach dem espionage act angeklagt und verurteilt zu werden. Das könnte Jahrzehnte im Gefängnis bedeuten.
Drei Whistleblower, die mit ihren öffentlichen Äußerungen über den angeblich „sauberen“ Krieg, der die eigenen Soldaten schont, sehr viel riskieren. Die Rechtsanwältin Jesselyn Raddack verteidigt mehrere Whistleblower und sagt: „Sie gehen sehr hohes persönliches Risiko ein“. Bei einigen sind inzwischen 1 Mio. Dollar Anwaltskosten aufgelaufen.
Die Interpretationshoheit der Bilder
„National Bird“ ist auch ein Film über Bilder, über den Krieg der Bilder und wer die Interpretationshoheit über sie hat. Die Aussagen der Whistleblower unterlaufen das Bild vom „sauberen Krieg“. Die visuelle Rekonstruktion des Angriffs ist sachlich und trocken, allerdings, wie in US-Dokumentarfilmen üblich, durch emotionalisierenden Musikteppich unnötig hochgepuscht.
Der Film liefert noch etwas dazu. Zur Schlüsselszene des Films, der Attacke vom Februar 2010 gehören auch Bilder, die afghanische Zivilisten von der Heimkehr der Toten gedreht haben, ungelenke, schwer lesbare Videobilder. Aber Beweise. Einwohner heben die Decken von den Toten, können hier jemanden identifizieren und da, man hört die Schreie der Überlebenden. Dieser Szene kann man sich schwer entziehen.
Und das ist auch die besondere dokumentarische Leistung des Films. In der Realität liegen Ursache und Wirkung tausende Kilometer weit auseinander. Hier wird gestorben und dort muss niemand Verantwortung übernehmen. Der Film knüpft Ursache und Wirkung wieder aneinander. Stellt den Zusammenhang her zwischen Joystick und Beinprothese. Im Krankenhaus in Kabul schwenkt die Kamera auf eine lange Reihe von Aktenordnern, greift einen heraus, auf dem Ordner steht: „Amputationen 500.100 – 550.000“.
Immer wieder zeigt Sonia Kennebeck auch Drohnenbilder von oben – friedliche Bilder. Stadtlandschaften aus Kabul. Oder auch in einer langen Kamerafahrt amerikanische Vorstädte von oben. Das kann zeigen: es geht auch friedlich. Es steckt aber auch eine Warnung drin: der Krieg kann auch hierherkommen und damit auch der Tod von oben.
„National Bird“ wurde von Wim Wenders und Errol Morris co-produziert. Auf deutscher Seite ist der NDR beteiligt. Der Film ist in einigen Kinos zu sehen und auf Kinotour unter Anwesenheit der Regisseurin. Termine auf der Website des Films: http://nationalbird-derfilm.de/