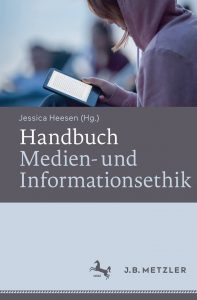Medienethik für Fernsehen, Radio, Presse – Informationsethik für die Moral im Internet? Diese Unterscheidung ist inzwischen obsolet geworden, denn beide Bereiche fließen in der alltäglichen Kommunikationspraxis immer stärker zusammen. Die Tübinger Medienethikerin Jessica Heesen hat nun ein Handbuch herausgegeben, das die beiden Teile angewandter Ethik erstmalig zusammenführt.
Heesen, Leiterin der Nachwuchsforschungsgruppe „Medienethik in interdisziplinärer Perspektive“ der Universität Tübingen, versammelt in dem Band renommierte Autor_innen verschiedener Fachrichtungen, um die neuen Herausforderungen digitaler Kommunikations- und Informationsstrukturen zu problematisieren. Zum Beispiel: Was bedeutet es, wenn nicht mehr Journalist_innen entscheiden, was berichtenswert ist, sondern auf Algorithmen basierte Suchmaschinen die Gatekeeper-Funktion übernehmen. Wer prägt nun die öffentliche Willens- und Meinungsbildung?
Bei der Meinungsbildung verlieren Leitmedien an Bedeutung. An ihre Stelle trete „die individuelle Komposition von Medienerlebnissen“, die sich zusammensetzen kann aus Fernsehkrimi, Twitter, Youtube-Video, SMS und Küchenradio. Die neue Medienkommunikation ist gekennzeichnet durch Pluralisierung und Individualisierung und durch die Nutzung von „Alleskönner“-Geräten wie Smartphones.
Medien- und Informationsethik haben in der digitalen Gesellschaft eine gemeinsame Aufgabe, die Heesen in ihrer Einleitung umreißt: Sie bewerten und steuern „das individuelle, gesellschaftliche und institutionelle Handeln für eine sozial verträgliche Gestaltung von Kommunikations- und Informationstechniken“, adressieren aber auch die Verantwortung jedes einzelnen bei der „Entwicklung, Verbreitung und Anwendung“ dieser Techniken.
Konkretisiert wird das in den recht vielstimmigen Beiträgen der wissenschaftlichen Fachautor_innen, die einzelne Problemfelder thematisieren. Diese sind in sieben Kapitel eingeordnet, wobei eines dem Journalismus gewidmet ist – mit Beiträgen zu Qualität, Nachrichtenwert oder Quellenschutz. Das mit 100 Seiten umfangreichste Kapitel “Informationstechnische Herausforderungen“ behandelt u. a. Algorithmen, Big Data, Cyberkriminalität, Geistiges Eigentum und Virtuelle Realität.
Die einzelnen Beiträge sind für sich verständlich und umkreisen aus verschiedenen Perspektiven ethisch zentrale Begriffe wie Öffentlichkeit, Verantwortung, Freiheit, Demokratie, Algorithmen, Digitalisierung. Als Stichworte im Sachregister verweisen diese wiederum auf die Themenbeiträge. Über das Sachregister erfahren interessierte Leser_innen z. B. auch, dass „Hacktivisten“ keine Cyberkriminellen sind oder dass „Kamerabrillen“ unsere Gefühlslage verraten können.
Literaturangaben am Ende der Beiträge und ein umfangreiches Personenregister vervollständigen das Handbuch, das sowohl als Lexikon als auch als Studien- und Lesebuch genutzt werden kann.
Jessica Heesen (Hrsg.): Handbuch Medien- und Informationsethik. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart/Weimar 2016. 378 Seiten (Hardcover oder E-Book). 89,95 bzw. 69,99 Euro, ISBN: 978-3-476-02557-9