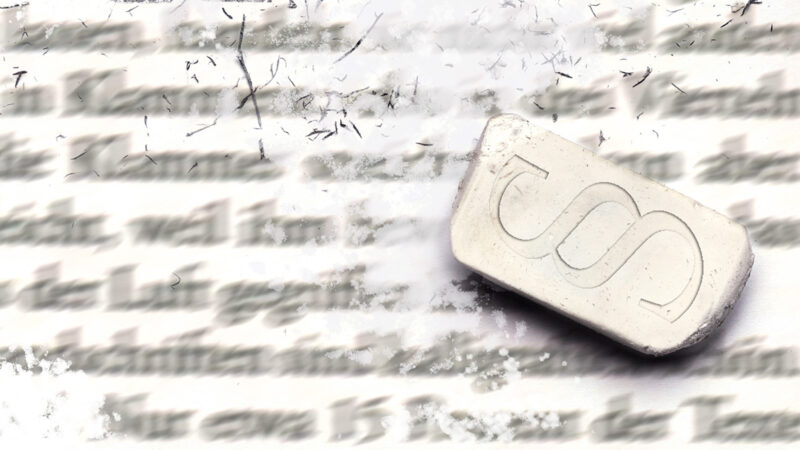Eine Studie der Universität Leipzig hat am Beispiel der deutschen Adelsfamilie Hohenzollern untersucht, wie kritische Berichterstattung und Forschung durch gezielte Anwaltsstrategien beeinflusst oder behindert werden sollen. Die Kommunikationswissenschaftler*innen haben dabei die Wirkung von SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation) aus Sicht der Betroffenen nachvollzogen. Verunsicherung und Einschränkung der Arbeitsfähigkeit sind direkte Folgen bei ihnen.
Im Jahr 2022 wurden in Europa rund 160 missbräuchliche Klagen eingereicht – der höchste je gemessene Jahreswert. „Die Dunkelziffer ist vermutlich höher“, so Dr. Uwe Krüger vom Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Uni Leipzig. Seit mehr als zehn Jahren sei eine wachsende „Verrechtlichung des Journalismus“ zu beobachten. Oft erhielten zum Beispiel TV-Politmagazine schon während ihrer Recherchen presserechtliche Warnschreiben von einschlägig bekannten Anwaltskanzleien: „Das ist zu einem Geschäftsmodell geworden und kein ausschließlich deutsches Phänomen“, sagt Krüger. Die Betroffenen – vor allem Journalist*innen, Umwelt- oder Menschenrechtsaktivist*innen, Künstler*innen oder Wissenschaftler*innen, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren – sollen mit zermürbenden und kostenintensiven rechtlichen Auseinandersetzungen eingeschüchtert werden.
Agenda-Cutting als Folge von Einschüchterungen
Die Hohenzollern sind in den vergangenen Jahren mit über 120 Klagen und Abmahnungen besonders massiv juristisch gegen öffentliche Äußerungen zur politischen Rolle der Familie im Nationalsozialismus vorgegangen. Beklagte waren Redaktionen und andere Beteiligte in der öffentlichen Berichterstattung, aber auch Historiker*innen. Das ist wohl der Grund dafür, dass sich für die Leipziger Studie lediglich zehn Betroffene zu Interviews bereit erklärten. Sie sagten übereinstimmend, dass die rechtlichen Schritte der Hohenzollern-Familie sie zumindest zeitweise erheblich verunsichert und in ihrer Arbeit eingeschränkt hätten.
Die Folgen bei den befragten Journalist*innen waren u.a. ein defensiverer Sprachgebrauch oder die gänzliche Vermeidung des Themas Hohenzollern. Wissenschaftler*innen dagegen vernetzten sich untereinander und forschten weiter. Sie äußerten sich aber seltener in den klassischen Medien. „Auch uns gegenüber wogen die Befragten ihre Worte sorgfältig ab“, so Connor Endt und Max Beuthner, die die Studie im Rahmen ihrer Masterarbeiten durchführten. Dies zeige, so Krüger, „die erhebliche Wirkung auf zweiter Ebene“ – nämlich die Beeinträchtigung der Redebereitschaft der Betroffenen sowie der Thematisierung der Fälle durch Beobachter*innen in Forschung und Medienjournalismus – eine Art „Debattenbremse“ also. Die korrekte kommunikationswissenschaftliche Bezeichnung ist Agenda Cutting (Unterbindung einer Debatte), wenn Medien ihrer Aufgabe, relevante Themen für die Öffentlichkeit aufzuarbeiten, nicht oder nur eingeschränkt nachkommen.
Post von der Anwaltskanzlei der Hohenzollern
Erfahrungen mit der Familie sammelte auch der Hamburger Journalist und Gewerkschafter Lars Hansen. Am 10. Juli 2020 hatte er in „M Menschen machen Medien“ einen Beitrag unter dem Titel „SLAPP – Pressefreiheit under pressure“ veröffentlicht. Darin ging es um beständig zunehmende Einschüchterungsklagen gegen Journalist*innen. Hansen hatte als Beispiel das juristische Vorgehen der Hohenzollern gegen unliebsame Berichterstattungen angeführt. Es reichte ein Satz, um von ihnen verklagt zu werden. Der Prinz von Preußen habe sich als „besonders klagefreudig erwiesen, was die wissenschaftliche und mediale Aufarbeitung der Geschichte seiner Familie angeht“. Bei Hansen wie auch den Befragten der Leipziger Studie ging es bei den beanstandeten Aussagen also nicht um den Kern der jeweiligen Sache, sondern eher um Nebensächlichkeiten – ein Indiz für rechtsmissbräuchliche SLAPP.
Die Drohschrift der Anwaltskanzlei raubte Lars Hansen dennoch kurzzeitig den Schlaf: „In dieser Situation war ich einmal mehr froh, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Ich bekam Rechtsschutz von ver.di und konnte aufatmen“, blickt er zurück. Am 19. August 2021 wies das Berliner Kammergericht die adeligen Kläger mit klaren Worten in die Schranken und ver.di gewann in zweiter Instanz gegen Georg Friedrich Prinz von Preußen. Eine andere Entscheidung, so die Vorsitzende Richterin des 10. Zivilsenats, würde „die Pressefreiheit in unzulässiger Weise beschneiden“.
Gesetzgeber muss Schutz leisten
Das Bewusstsein rund um SLAPPs und die Folgen wächst. In der Europäischen Union soll in den kommenden Monaten eine Anti-SLAPP-Richtlinie über Zivilsachen mit grenzüberschreitendem Bezug veröffentlicht werden. Die Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, entsprechende nationale Gesetze zu erlassen. In Deutschland gibt es noch nicht einmal einen Gesetzentwurf. „Im Licht unserer Forschungsergebnisse erscheint es richtig und wichtig, dass der Gesetzgeber sich jetzt darum kümmert, Kritiker, Kontrolleure und Aufklärer in der demokratischen Gesellschaft zu schützen“, unterstreicht Krüger.
Die Studie wurde in der Fachzeitschrift „Publizistik“ unter dem Titel „Agenda-Cutting durch SLAPPs? Die Klagen der Hohenzollern und ihre Wirkung auf die Presse- und Wissenschaftsfreiheit aus Sicht der betroffenen Journalisten und Forscher“ veröffentlicht und kann dort als PDF heruntergeladen werden. Download der Studie