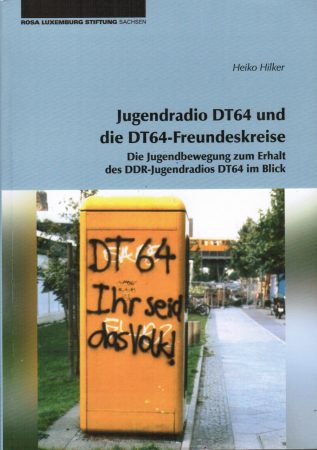Morgenrock, Hitglobus, Parocktikum oder Schlafstörung – so hießen Sendungen von DT64. Aus dem Programm für junge Leute, in einem Sonderstudio des DDR-Rundfunks zum Deutschlandtreffen der Jugend 1964 gestartet, wurde erst 1986 ein eigenständiger Sender. In der Wendezeit Kult, sammelte sich um das Radio Anfang der 1990er Jahre breiter Protest für den Erhalt. Der Rückblick eines damaligen Aktivisten, der die Bewegung auch theoretisch einordnet, wurde jetzt publiziert.
DT64 hatte eine beträchtliche Fangemeinde – vor allem, weil das Radio zielgruppengerecht mit guter Musik aus Ost und West und deutsch gesungenen Titeln von DDR-Bands den Nerv junger Leute traf. Es lieferte auch Politisch-Informatives, was aber lockerer und frecher daherkam als auf anderen DDR-Sendern. DT64 sei ein Radio für Leute gewesen, „die das System nicht abschaffen, sondern verbessern“ oder einfach ihre Musik hören wollten. 1989 übernahm DT64 eine Vorreiterrolle: Die Redaktion berichtete frühzeitig über Montagsdemonstrationen, setzte wenig später ihre Leitung ab, wählte sich einen neuen Chefredakteur und war ab 1. April 1990 unter dem Motto „Power from the East Side“ als Vollprogramm rund um die Uhr auf Sendung.
Dann wurde DT64 gemäß Rundfunküberleitungsgesetz nach Einigungsvertrag weitergeführt, musste aber bis Ende 1991 in öffentlich-rechtliche Form überführt oder abgewickelt werden. Diese Aussicht – und die Tatsache, dass die DT64-Frequenzen außerhalb Berlins am 7. September 1990 unangekündigt kurzzeitig vom RIAS gekapert wurden – rief ungeahnte Proteste und eine regelrechte Jugendbewegung mit beachtlichem Medienecho hervor.
Noch ganz ohne Internet und Soziale Medien brachte sie Demonstrant*innen – 10.000 allein am 16. November 1991 in Dresden – und Mahnwachen auf die Straße, führte Ende 1991 zur Besetzung der Potsdamer Staatskanzlei, gewann prominente Unterstützer*innen und mobilisierte vernetzte Freundeskreise in Ost und West. Ihnen war es wesentlich zu danken, dass sogar dem Deutschen Bundestag im Dezember 1991 ein Entschließungsantrag zum Erhalt von DT64 debattiert (und abgelehnt) wurde. Nach Personalabbau, Frequenzpoker und medienpolitischem Kompetenzgerangel wurde das Jugendradio letztlich im Mai 1993 in „Sputnik“ umbenannt in den MDR eingegliedert.
Mit der Geschichte von DT64, vor allem aber mit dieser sozialen Bewegung ab 1990 beschäftigt sich die umfangreiche Abhandlung von Heiko Hilker, damals bundesweiter Koordinator der DT64-Freundeskreise, heute Chef des Dresdner Instituts für Medien, Bildung und Beratung. Ende 2020 erschienen, beruht die Publikation allerdings auf einer Manuskriptfassung von 1995, die als „Dokument ihrer Zeit“ weitgehend unbearbeitet blieb und vom Autor als Diskussionsangebot gesehen wird.
Tatsächlich wurde, ausgehend von der Idee zweier Chemnitzer Studenten zu Pfingsten 1991, über lokale Freundeskreise eine regelrechte „Lawine“ von öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten in Gang gesetzt, zehn überregionale Netzwerktreffen eingeschlossen. Die vom Autor zusammengetragene Chronik füllt 22 Buchseiten. Dass sich die Aktiven beispielhaft engagierten und organisierten ist einer hohen Identifikation mit dem Sender geschuldet. Den Macher*innen von DT64 wurde offenbar attestiert, dass sie sich – wie es später Alexander Osang formulierte – „nicht so leichtfüßig von der DDR verabschiedet (haben) wie andere. Es war ihre späte Chance, Charakter zu zeigen. Sie haben sie genutzt.“
Ausführlich betrachtet Hilker in seiner Abhandlung die DT64-Freundeskreise und ihre Aktionen als spezifischen Ausdruck von Jugendkultur, analysiert deren Erfahrungen in Basisdemokratie, Erfolge bei Spendenfinanzierung und wirkungsvoller Öffentlichkeitsarbeit, zieht Schlüsse für politische Sozialarbeit, sozialpädagogische Arbeitsprinzipien und Mobilisierungsmöglichkeiten.
Hilker will erklärtermaßen kein abschließendes Urteil über das Phänomen DT64 fällen. Sicher gut so, denn spätestens mit Fridays for Future sind junge Bewegungen in neuer, globaler Dimension entstanden. Davon war 1995 noch nichts zu ahnen. Der Autor untersuchte und sah „Zeichen einer ‚spezifisch ostdeutschen Ästhetik des Widerstands‘“. Doch zog er ausdrücklich bereits allgemeinere Lehren für Bewegungen, die auf gesellschaftliche Veränderungen gerichtet sind. Sie haben für den öffentlichen Diskurs eher an Aktualität gewonnen.
Heiko Hilker: Jugendradio DT64 und die DT64-Freundeskreise. Die Jugendbewegung zum Erhalt des DDR-Jugendradios DT64 im Blick. Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen, Leipzig 2020, 374 Seiten, 15 Euro; ISBN 978-3-947176–14-4