Mit der Allgegenwart von Bildern im Journalismus ergeben sich täglich neue medien- und bildethische Fragestellungen. Und zwar sowohl für die Journalist*innen als auch für die Rezipient*innen. Einen Überblick über die damit verbundenen Fragestellungen bietet der neue Band „Bildethik“ des Kommunikationswissenschaftlers Christian Schicha. Zielgruppe der Veröffentlichung sind vor allem Studierende und Lehrende aus den Bereichen Medien- und Kommunikationswissenschaft.
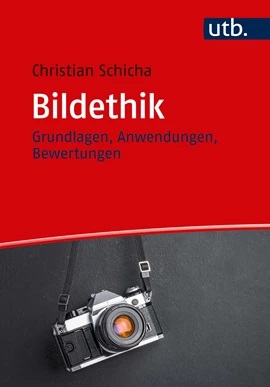
Trotz der Relevanz ethischer Fragestellungen in der Bildkommunikation sind Publikationen zum Thema Bildethik, sei es aus Praxis- oder Wissenschaftsperspektive, auf dem Buchmarkt rar gesät. Umso wichtiger erscheint der im Frühjahr 2021 im Münchner UVK Verlag in der Reihe utb. veröffentlichte Band „Bildethik“. Autor ist mit Dr. Christian Schicha, Professor für Medienethik am Institut für Theater- und Medienwissenschaft der Universität Erlangen-Nürnberg, ein versierter Experte auf diesem Themenfeld. Auf 300 Seiten mit fast 60 Abbildungen beschäftigt er sich mit Grundlagen, Anwendungen und Bewertungen der Bildkommunikation aus einer normativen Perspektive.
Bereits in der Einleitung legt Christian Schicha dar, dass es bei der Beschäftigung mit Bildethik „nicht um Geschmacks-, sondern um Werturteile (geht), also um die Frage nach welchen Kriterien zu entscheiden ist, welche Bilder in welchem Kontext unter welchen Bedingungen welchem Personenkreis gezeigt werden und in welchen Fällen auf Veröffentlichung von Aufnahmen aufgrund gut begründeter Normen und Werte verzichtet werden sollte“. Dem folgt im nächsten Kapitel eine Beschäftigung mit den Grundlagen der Bildkommunikation. Im Kapitel Anwendung stellt der Autor fast zwei Dutzend Fotograf*innen vor und diskutiert Beispiele, die vom Fotojournalismus über die Kriegsberichterstattung und die Werbung bis hin zur Satire reichen. Das letzte Kapitel besteht vor allem aus einer kommentierten Auswahlbibliographie sowie einer Sammlung und Vorstellung von Initiativen aus dem Bereich der visuellen Kommunikation, der Pressefreiheit sowie der Medienpädagogik.
Wer trägt Verantwortung?
Schnell wird bei der Lektüre deutlich, wie komplex das Thema ist und wie stark Fragen der Bildproduktion, der Bildverwendung und der Bildwahrnehmung miteinander verknüpft sind. Aufschlußreich ist dabei Schichas Aufschlüsselung verschiedener Verantwortungsebenen zwischen den einzelnen Journalist*innen, der Profession, den Medienunternehmen und den Mediennutzer*innen. Dies zeigt sich vor allem bei der Diskussion von Beispielen aus der Kriegsberichterstattung oder der Werbung. Dabei sind es vor allem die interessanten Querverweise, etwa auf fiktionale Spielfilme, die das Aufgreifen bekannter Beispiele aus der Konfliktikonografie wie dem 11. September zu einer Bereicherung machen. Zwischen der Diskussion politischer Bilder im Wahlkampf, von Strategien der Selbstinszenierung durch Selfies sowie der Instrumentalisierung der Mohammed-Karikaturen entsteht so ein vielschichtiges Panorama bild- und medienethischer Fragestellungen.
Anregung zur Reflektion
Für Bild- und Textredakteur*innen ist das Buch vor allem als Nachschlagewerk und Anregung zur Reflektion der eigenen Praxis interessant. Es bietet die Möglichkeit, über den Tellerrand des redaktionellen Alltags hinauszuschauen und die eigene Arbeit in komplexeren Debatten um das Verhältnis von Bild und Text sowie bildwissenschaftliche Fragestellungen einzubetten. Trotz des wissenschaftlichen Anspruchs der Publikation und der damit verbundenen akademischen Zielgruppe ist der Band gut lesbar.Die Gedankengänge sind gut nachvollziehbar. Schade ist gleichwohl, dass der redaktionellen Praxis nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird und dass die Herausforderungen digitaler Kommunikation auf den sozialen Netzwerken nur am Rande vorkommen.
Christian Schicha, Bildethik, UVK, 305 Seiten, 1. Auflage, ISBN: 978-3-8252-5519-0


