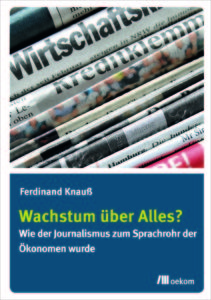Der „Club of Rome“ stellte erneut eine Studie vor, die auf die verheerenden Folgen unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems hinweist. Der erste dieser Berichte sorgte 1972 für Aufsehen und prägte mit seinem Titel einen bis heute zentralen Begriff: „Die Grenzen des Wachstums“. Die gesellschaftspolitischen Forderungen des neuen Werks sind unkonventionell und haben dementsprechende Kritik provoziert. Aber damals wie heute lautet die zentrale Aussage: Hört auf mit eurem Wirtschaftswachstumswahn! Ähnliches ruft auch Ferdinand Knauß nun in seinem kürzlich erschienenen Buch „Wachstum über Alles? Wie der Journalismus zum Sprachrohr der Ökonomen wurde“ seiner Zunft zu.
Der Redakteur der „Wirtschaftswoche“ hat sich letztes Jahr eine Auszeit genommen, um eine Forschungslücke zu verringern: Mittels einer Auswertung von „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Die Zeit“ und „Der Spiegel“ hat er nachvollzogen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg das Setzen auf wirtschaftliches Wachstum zum primären Mittel der Wirtschaftspolitik und bald zum Paradigma wurde. – Einem Paradigma, das auch in der Wirtschaftspresse vorherrschte und bis heute noch vorzuherrschen scheint.
Der Autor zeigt zunächst die Vorgeschichte auf. Die Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaft und die Erfindung des Bruttosozialprodukts sorgten für vermeintlich einfache, objektive Kennzahlen. Damit verschaffte die neue Sparte der Wirtschaftsanalyse dem Journalismus Autorität. Sie war sogar die Geburtshelferin des Begriffs „Wirtschaftsjournalismus“, den es laut Knauß vor 1933 nirgendwo in Deutschland gab.
Knauß‘ Analyse zufolge muss ab den 1960ern von einem Wachstumsfetisch gesprochen werden. In der „FAZ“ gaben da noch Autoren den Ton an, die Wachstum nicht als Selbstzweck ansahen. Doch genau das wurde es, ablesbar schon an der ersten Regierungserklärung von Kanzler Kurt Georg Kiesinger 1966. Das Wachstumsparadigma wurde nun massiv von „Zeit“ und „Spiegel“ gestützt. Staatliches Eingreifen, Planbarkeit der Wirtschaft, Vergrößerung des Wachstums und somit des zu verteilenden Kuchens statt Verteilungskämpfe – das galt ihnen als modern und von der objektiven Wirtschaftswissenschaft gestützt. Für Knauß ist diese unkritische Haltung das wirtschaftsjournalistische Versagen zweier Blätter, die sich auf die Fahnen schreiben, in jener Zeit den Regierungen mächtig Gegenwind beschert zu haben.
In den 1970ern tat sich die Möglichkeit einer Wende auf: Ökologische Probleme brachen ins Alltagsbewusstsein ein, „die Grenzen des Wachstums“ wurden zum geflügelten Wort. Doch hier schon macht Ferdinand Knauß eine Spaltung aus, die er auch heute feststellt: In den Feuilletons und von dem einen oder anderen Wissenschaftsredakteur wird die Wachstumskritik positiv aufgenommen, in den Politik- und Wirtschaftsressorts – vor allem in der Tagesberichterstattung – hingegen eher abgelehnt. Der Wirtschaftsjournalismus ist in dieser Hinsicht bis heute vor allem ein unkritisches Anhängsel von ideologischen Forschungsinstituten und Regierungen, lautet Knauß‘ Fazit.
Der Autor kann auf zwei relativ aktuelle Studien zum deutschen Wirtschaftsjournalismus verweisen und seine Kritik theoretisch unterfüttern. Das Buch deckt viele Themen ab und ist erhellend, vor allem dank seiner vielen Zitate (mitunter brächten weniger sogar mehr). Zur Behebung der wirtschaftsjournalistischen Misere schlägt Ferdinand Knauß mehr Kooperation von Feuilleton und Wirtschaftsressort vor, um gesellschaftliche Fragen umfassend zu behandeln.
Studien:
http://www.denkwerkzukunft.de/index.php/aktivitaeten/index/Medienanalyse