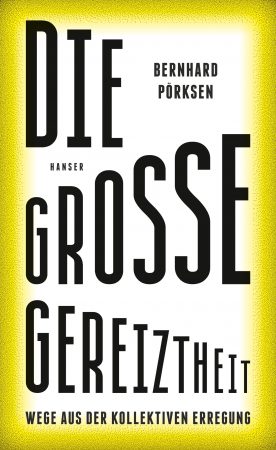Eine bloße Bemerkung in der digital vernetzten Welt kann folgenreich sein: Sie kann einen Diskurs über gesellschaftliche Missstände auslösen, aber auch politische Konflikte anheizen oder persönliche Karrieren zerstören. Bernhard Pörksen analysiert in seinem Buch „Die große Gereizheit“, wie das kommunikative Klima in Hektik und Hass umschlägt und entwirft eine Medienethik für die „vernetzten Vielen“.
Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, hat sein Buch nach einem Kapitel aus Thomas Manns „Der Zauberberg“ benannt. Die Stimmung vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird im Roman beschrieben als „Verunsicherung, Aufgewühltheit und plötzlich hervorbrechenende Wut“ – Phänomene, die nach Pörksen auch den aktuellen kommunikativen Klimawandel prägen. Er spürt ihnen in fünf „Krisen“-Kapiteln nach, um analog zur journalistischen Berufsethik eine konkrete Utopie publizistischer Verantwortung für eine „redaktionelle Gesellschaft“ zu entwickeln. „Medienmündigkeit“ werde zu einer „Existenzfrage der Demokratie“.
Zunächst diagnostiziert der Autor eine „Wahrheitskrise“. Gewissheiten, die Journalist_innen als „vergleichsweise mächtige Gatekeeper“ vermitteln, weichen demnach einer „informationellen Verunsicherung“ darüber, was „denn nun stimmt und wer denn nun mit welchen Absichten und Interessen spricht“. Dadurch könne die Vielfalt von Weltdeutungen näher gebracht werden. Häufig begünstige die „Unaushaltbarkeit der Ungewissheit“ aber eine passgenaue Wirklichkeitswahrnehmung, Rezipierende mit solch verengter Perspektive verbarrikadierten sich dann in einer Echokammer vorgefasster Meinungen.
Durch den Aufstieg von Plattform-Monopolisten wie Google und Facebook und den Vertrauensverlust klassischer Medien komme es zu einer „Diskurskrise“, geprägt durch die Entgrenzung des Sagbaren und Konsensfähigen. Außer Hassbotschaften und pauschalen Konspirationsbehauptungen könne die „fünfte Gewalt“ der vernetzten Vielen aber auch bisher „zu Unrecht marginalisierte Standpunkte sichtbar“ machen wie etwa #Aufschrei, der 2013 eine Debatte über Sexismus in der Gesellschaft angestoßen hatte.
Die neue Transparenz durch die „grell ausgeleuchtete Medienwelt“ führe zu einer „Autoritätskrise“, denn Idole und politische Eliten würden schnell entmystifiziert. Betroffene reagierten darauf mit ängstlicher Anpassung oder Inszenierung eines Anti-Helden-Images durch bewusste Werteverletzung. Möglich sei aber auch mehr Toleranz gegenüber menschlichen Schwächen seitens der „Leute, die man früher Publikum nannte“.
Wie durch die Vernetzung lokal begrenzte Konflikte eskalieren, Kontexte zusammenbrechen und Lebenswirklichkeiten aufeinander prallen, problematisiert Pörksen unter „Behaglichkeitskrise“. Diese werde durch eine gefühlsgesteuerte Relevanzhierarchie befördert. Ein Reizthema kann so ganze Konfliktkaskaden auslösen – etwa 2010, als ein Pastor in den USA für den 11. September eine Koranverbrennung ankündigte und weltweites Echo in Netz und Leitmedien fand. Bei Protesten starben dann 16 Menschen. Aber Ignorieren solcher Themen helfe nicht. Es gelte, mit eigenen Affekten sorgfältig umzugehen und immer zu fragen, was „im Sinne engagierter Zeitgenossenschaft“ wirklich wichtig ist.
Durch das Zusammenwirken von Kontextausblendung und Ad-hoc-Diffamierung komme es zur „Reputationskrise“, die persönliche Karrieren von ganz normalen Menschen zerstören kann. Ein Beispiel ist Lindsey Stone, die 2012 bei einem Washington-Ausflug auch den Nationalfriedhof Arlington besuchte und ein Bild auf Facebook postete. Es zeigt sie vor dem Eingangsschild, das „Silence and Respect“ fordert, mit Stinkefinger und zum Schreien geöffneten Mund – ein Scherzbild wie andere, mit denen sie sich über Autoritäten lustig macht, wenn sie „Rauchen verboten“ mit einer Zigarette kommentiert. Doch im Netz wurde das als Beschmutzung des Ansehens gefallener Soldaten skandalisiert und sie verlor ihren Job. Da Skandalisierung nicht nur der Diffamierung, sondern auch der Aufdeckung sozialer Missstände dienen kann, müssen sich nicht nur Journalist_innen, sondern alle, die im Netz unterwegs sind, die „klassischen Fragen nach der Relevanz, der Glaubwürdigkeit und der Überprüfbarkeit von Informationen“ stellen.
Pörksen macht drei „Kraftzentren’“ in der digitalen Öffentlichkeit aus, die publizistische Verantwortung haben: „das medienmächtige Publikum“, den „real existierenden Journalismus“ und die „Wirkmacht von Plattformen“. Die Normen eines ideal gedachten Journalismus sollten in der „redaktionellen Gesellschaft“ zur Allgemeinbildung und zum Ethos gehören, um die Folgen der eigenen Kommunikation kompetent reflektieren zu können. Dazu zählten Erziehung zur „Medienmündigkeit“ in der Schule, ein dialogischer, weniger hierarchischer, von der fünften Gewalt inspirierter Journalismus und Diskurs- und Transparenzpflichten für Plattformbetreiber.
Das gut lesbare Buch ist stringent gegliedert und die aus Gesprächen und Literatur gewonnenen Thesen zur Janusgesichtigkeit der digital vernetzten Welt werden durch viele Beispiele veranschaulicht. Die Lektüre gibt produktive Denkanstöße zum Ausstieg aus dem „ungesunden Erregungsspiel“ der aktuellen Medienwelt und für mehr digitale Lebenskompetenz. Anregungen finden nicht nur Journalist_innen, Wissenschaftler_innen und Politiker_innen, sondern alle, die den kommunikativen Klimawandel für mehr Demokratie nutzen wollen.
Bernhard Pörksen: Die große Gereiztheit. Wege aus der kollektiven Erregung. Hanser Verlag, München 2018. 256 S. 22 Euro. ISBN: 978-3-446-25844-0