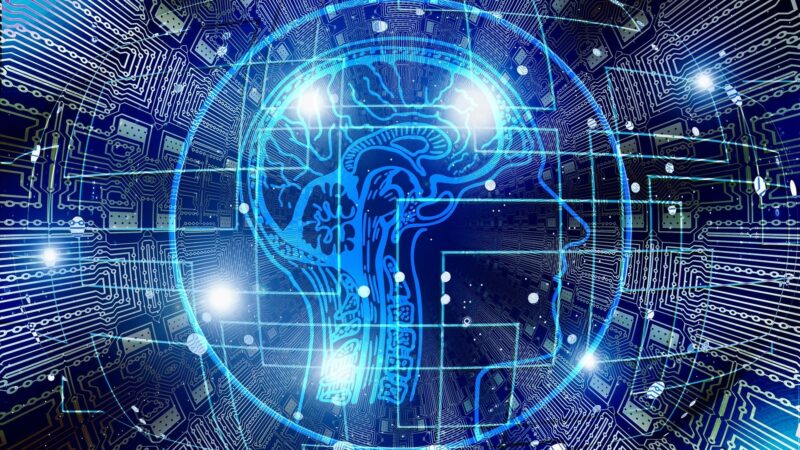Klare Regeln für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) fordern Schauspieler*innen, Schriftsteller*innen oder Journalisten*innen immer drängender. In der Reihe „DGB-Dialog Künstliche Intelligenz“ ging es am 22. Februar um „Alles Fake?! KI in Medien und Kultur“. Mittlerweile werde die generative KI so mächtig, dass sie Teile menschlicher Arbeit tatsächlich ersetzen könne, hieß es in der Diskussion.
„Der Mensch wird nicht zu ersetzen sein“, zeigte sich Hans-Werner Meyer, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Schauspiel (BFFS) für seine Zunft sicher. Beim Schauspiel gehe es doch um die Seele, den Funken, der auf das Publikum überspringe – oder auch nicht. Ohne die Improvisation entfalle das überraschende Moment, so der Schauspieler. Für ihn ist nicht die KI, sondern die Monopolisierung der Wertschöpfung durch die großen Player wie Apple und Amazon das Problem. Dennoch ist er sich sicher, dass Regeln wie Pflichten zur Kennzeichnung, zur Transparenz oder zur Vergütung dringend nötig seien. Es gehe um viel Kleinteiliges, etwa wenn sein Gesicht auf das eines Stuntman projiziert werde und er weniger Drehtage habe.
Mitbestimmung angemahnt
Noch seien die deutschen Schauspieler*innen von KI hierzulande nicht so betroffen wie die US-Kolleg*innen, die im vergangenen Jahr unter anderem wegen der fehlenden Regelungen wochenlang gestreikt haben, sagte Meyer. Aus seiner Sicht steht die Filmindustrie insgesamt unter Druck, wobei nicht die Produzenten der Gegner seien. Die Schauspieler*innen wollen über die Regeln mitbestimmen, wenn Daten digitalisiert, Darstellungen digital bearbeitet, digitale Klone erzeugt oder sie komplett durch die KI ersetzt werden.
Verbindliche Regeln mahnte auch Matthias von Fintel, ver.di-Bereichsleiter Medien und Publizistik, an. Bei der Filmindustrie sei man dabei, gerade noch rechtzeitig dabei, ein umfassendes Regelungsmodell aufzusetzen. Standards seien auch in anderen Bereichen wie dem Journalismus nötig. Vor allem, wenn die gegenwärtige Debatte beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder auf Einsparungen reduziert werde. Mal sei es ein Drehtag, mal solle die KI eine Doku erstellen. Gleichwohl sehe er auch Chancen für Journalist*innen, etwa bei der Angst vor einem leeren Blatt. Mit ChatGPT könnten Ideen entstehen. Gerade für freie Journalist*innen könnte das hilfreich sein, die unter erheblichem Honorardruck arbeitete und schneller zu Ergebnissen kommen müssten. Außerdem gebe es zahlreiche Assistenzsysteme, die die Arbeit erleichterten, etwa bei der Optimierung von Überschriften oder dem SEO. Entscheidend sei jedoch, Herr oder Herrin über das eigene Wort und Werk bleiben. Mit der geforderten Kennzeichnungspflicht müsse klar erkennbar sein, wo und in welchem Umfang KI eingesetzt werde. Von Fintel plädierte zugleich dafür, dass Mitarbeiter*innen ein Mitbestimmungs- und Informationsrecht bei der Einführung der KI bekämen.
Von Aufklärung und Plagiatsmaschinen
Michael Steinbrecher, Professor am Institut der TU Dortmund, verwies auf das Argument der KI-Anbieter, sie nähmen den Journalisten nichts weg, sondern würden nur das Schwarzbrot übernehmen. Darunter fielen Sportergebnisse oder „Dinge, auf die keiner Lust hat“. Fraglich bleibe, ob die KI nicht zukünftig mehr übernehme und dadurch möglicherweise Redakteursstellen nicht nur im Bereich „Schwarzbrot“ abgeschafft würden. Es gebe nicht nur Edelfedern in den Redaktionen. „Ich habe Sorge, dass sich das ganze System ändert. Wir wissen durch KI sehr genau, wer die Nutzer sind. Redet der Journalist dann irgendwann dem Nutzer nach dem Mund?“ Wenn die Informationen nur noch von der KI geliefert würden, welche Auswirkungen habe das auf die gesellschaftlicher Debatte, fragte Steinbrecher. Er plädierte für mehr Aufklärung, warum es den Journalismus brauche.
Die Schriftstellerin Nina George nannte ChatGPT und Co. „Plagiatsmaschinen“. Sie gründeten ihr Geschäft auf Massendiebstahl. Von ihr seien zwei Bücher ungefragt und unbezahlt in das Large Language Model eingeflossen. Insgesamt seien rund vier Millionen Dokumente, Texte und Bücher dafür genutzt worden, sagte George. Sie forderte, dringend den Paragrafen 44b im Urheberrecht zu Text und Data Mining abzuschaffen oder zu reformieren. Sie müsse als Autorin selbst entscheiden können, wie ihr Werk genutzt und vervielfältigt werde. Es sei auch würdelos, ihr unter Schmerzen entstandenes Werk „Das Lavendelzimmer“ für das Maschinenlernen zu nutzen. Die Branche müsste gemeinsam handeln. Die Autor*innen sollten ihre Werke schützen können.