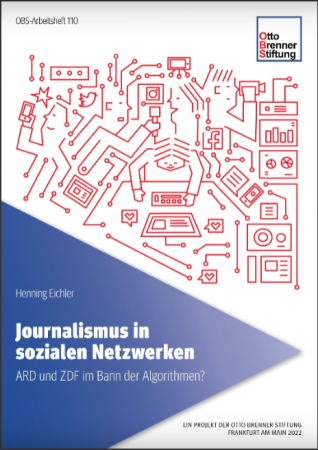Journalistische Inhalte sind aus sozialen Netzwerken kaum wegzudenken. Das ist auch gut so, denn gerade jüngere Menschen suchen genau dort nach Informationen und politischer Einordnung. Gerade die Öffentlich-Rechtlichen dürfen daher im Internet nicht fehlen. Doch wie verändern sich ihre journalistischen Inhalte, wenn sie für Plattformen produziert werden und was bedeutet die Plattformisierung für ihre Qualität. In einer Studie der Otto-Brenner-Stiftung geht der Autor Henning Eichler diesen Fragen nach. Auf der Berliner Digitalkonferenz re:publica präsentierte er seine Ergebnisse einem Fachpublikum.
Die Studie über „Journalismus in sozialen Netzwerken“, untersucht die öffentlich-rechtlichen Angebote auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok, Snapchat, Telegram und Pinterest sowie auf LinkedIn und Xing. Der Journalist Henning Eichler hat dafür 273 journalistische Formate von ARD, ZDF und Deutschlandradio in den sozialen Medien analysiert und 18 Personen aus Redaktionen und Management befragt.
Auf der re:publica interessieren sich zahlreiche Zuschauer*innen für die Studienpräsentation an Deck eines Schiffes auf der Spree. Eichler beschreibt zunächst das Problem des Journalismus in den sozialen Netzwerken, als einen Konflikt zwischen Werteorientierung und kommerzieller Plattform-Logik. Inhaltliche Entscheidungen seien mittlerweile „an Reichweiten und algorithmischen Funktionen ausgerichtet“. So komme es vor, „dass manche journalistische Themen auf bestimmten Plattformen nicht mehr umgesetzt werden, weil sie in der Vergangenheit keine guten Kennzahlen erzielten“. Auch bestimmten die algorithmischen Selektionsmechanismen welche Inhalte an welche Nutzer*innen ausgespielt würden. So entstehen personalisierte Nachrichtenangebote, die eine gesellschaftliche Fragmentierung befördern und Konsensbildung erschweren.
Die Plattformen übten durch ihre Wirkungsmechanismen großen Einfluss sowohl auf Zuschauer*innen als auch auf die öffentlich-rechtlichen Inhalte aus, konstatiert die Studie. Das gilt etwa für die Länge und die Optik der Beiträge, die plattformspezifisch unterschiedlich ist. Doch Sendungsverantwortliche sagten gegenüber Eichler, dass zunehmend auch die inhaltliche Auswahl der Themen dadurch beeinflusst wird, was von den Plattformen algorithmisch verstärkt wird und viele Interaktionen generiert. Man produziere guten Content und gebe ihn dann einfach aus der Hand, sagt Eichler und klingt ein wenig niedergeschlagen.
In der anschließenden Diskussion gibt ein junger Journalist, der für den WDR arbeitet, zu bedenken, dass bestimmte Plattformlogiken auch Ansporn sein können, besser zu werden. „Wir haben viel an unserem Storytelling gearbeitet, um Themen auf eine interessantere Weise zu erzählen“, gibt er zu bedenken. Das werde von den Usern durchaus belohnt.
Denn was auf Sozialen Medien funktioniert, bestimmen auch die User. Dieses Dilemma zwischen journalistischem Anspruch und autonomer Themenwahl auf der einen, und Reichweitenmaximierung auf der anderen Seite, ist allerdings nicht neu. Es ist auch kein Phänomen der Plattformen. Die Frage nach Einschaltquoten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk spielten bereits im vergangenen Jahrtausend eine Rolle.
Öffentlich-rechtliche Angebote und Redaktionen können durchaus auch von Plattformen profitieren. Das öffentlich-rechtlichen Jugendangebot Funk erreicht beispielsweise Zielgruppen, die lineare Medien gar nicht mehr erreichen. Das tun sie zum Teil natürlich auch mit anderen Themen.
Da klingt das Fazit der Studie ein wenig mutlos: Redaktionen und Medienhäuser seien in der Pflicht, verbindliche Leitlinien für öffentlich-rechtlichen Journalismus in sozialen Netzwerken aufzustellen. Zugleich müsse der Ausbau unabhängiger und nicht-kommerzieller Plattformen und eine stärkere Regulierung der Netzwerke und ihrer Algorithmen vorangetrieben werden.
Die Idee mit den unabhängigen Plattformen hält aber selbst Eichler für unwahrscheinlich. Denn neben fehlenden Ressourcen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat er dort auch wenig Platz für Innovationen entdeckt.