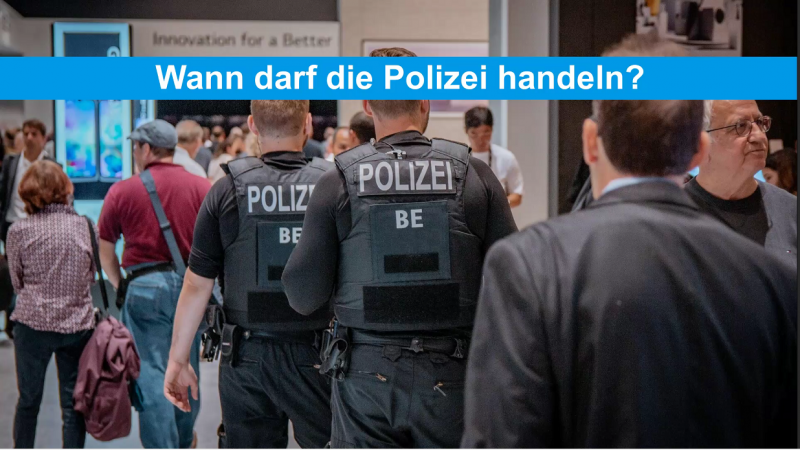Bei Demonstrationen passiert es Journalist*innen leider schnell, dass sie mit der Polizei in Konflikt geraten. Da ist es nicht nur gut, seine Rechte zu kennen, sondern auch gut zu wissen, wie man notfalls schnell zu seinem Recht kommt. Die Hamburger dju in ver.di hatte dazu einen Workshop mit dem Medienrechts-Anwalt Jasper Prigge Corona-bedingt zur Online-Veranstaltung umorganisiert. Der vermeintliche Nachteil geriet zum Vorteil: Über 60 Teilnehmer*innen waren aus der gesamten Bundesrepublik eingeloggt. Mehr, als zu einem Präsenzworkshop nach Hamburg gekommen wären.
„Fortschicken, festhalten, fernhalten… Journalist*innen und Polizeibeamt*innen im Einsatz: Wer darf was – und was nicht?“ – so das Workshop-Thema. Ob Platzverweise, das Bedrängen von Journalist*innen am Rand von Veranstaltungen, das Verweigern von Hilfe oder gar die Forderung nach der Löschung oder Herausgabe von Fotomaterial: Die Liste der Beschwerden von Kolleg*innen über das Verhalten von Polizist*innen der Presse gegenüber bei Kundgebungen ist lang. Nicht immer seien diese Verfehlungen gemeine Willkür, machte Rechtsanwalt Jasper Prigge deutlich. Oft beruhen sie auf Missverständnissen oder Unkenntnis. „Aufgabe der Polizei ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Verfolgung von Straftaten. Zu beidem hat die Polizei das explizite Recht, unmittelbaren Zwang anzuwenden“, sagt Prigge. „Dem gegenüber stehen das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Freiheit der Berichterstattung sowie zahlreiche andere hohe Rechtsgüter, die Polizeibeamte nicht nur berücksichtigen, sondern auch schützen müssen. Dabei müssen sie im Einsatz ständig Ad-hoc-Entscheidungen treffen.“
Hilfreich sei es deshalb, klar als Journalist erkennbar zu sein, und in einer Situation auch in dieser Rolle zu bleiben. „Das kann das sichtbare Tragen des Presseausweises sein, der Aufdruck „Presse“ auf der Kleidung, oder sonst irgendetwas, das einen schon optisch von den Teilnehmenden einer Demonstration abhebt“, sagte Jasper Prigge. Wenn er als Anwalt einer Demonstration beiwohne, würde er beispielsweise Anzug tragen. Das und der Doktorgrad auf seiner Visitenkarte würden seine Kommunikation mit der Polizei deutlich erleichtern. Gut sei es auch, sich vor der Demonstration beim Einsatzleiter bekannt zu machen oder zumindest vorher die Pressestelle der Polizei informiert zu haben, dass man zu berichten gedenkt.
„Ich kann nun nicht von jedem verlangen, seinen persönlichen Kleidungsstil zu verleugnen, aber es hilft, sich erkennbar von den Teilnehmern zu unterscheiden. Deshalb ist es auch nicht hilfreich, in solchen Situationen eine Doppelrolle einzunehmen und gleichzeitig Aktivist und Journalist zu sein. Im Ernstfall spricht die Polizei den Betroffenen dann die Journalist*innen-Eigenschaft zunächst ab und behandelt sie als Störer.“ Kommt es zu einem Konflikt, rät Prigge, besonnen zu bleiben und sich nicht einschüchtern zu lassen. „Man sollte hinterfragen, wer etwas angeordnet hat, wie die Anordnung lautet, wann und warum sie ausgesprochen wurde.
Ein häufiges Konfliktfeld ist die Fotografie, vor allem seit die Datenschutz-Grundverordnung das Persönlichkeitsrecht gestärkt hat. „Es ist immer noch erlaubt, Personen zu fotografieren, sofern sie ein Zeugnis der Zeitgeschichte darstellen. Einfache Einzelaufnahmen ohne erkennbaren zeitgeschichtlichen Kontext werden allerdings schwierig.“, erläutert Prigge. „Das bezieht sich allerdings auf die Veröffentlichung. Ein Verbot zu fotografieren lässt sich daraus nicht ableiten.“ Genauso wenig könne die Löschung von Aufnahmen oder gar ganzer Datenträger verlangt werden. Erst recht nicht könne die Polizei verlangen, dass man Bildmaterial zur Verfügung stelle, um bei der Verfolgung vermeintlicher oder tatsächlicher Straftaten zu helfen.
Eindeutige Aussagen über die rechtliche Situation der Presse bei Demonstrationen ließen sich leider nicht treffen, bedauert Jasper Prigge. Zu viele verschiedene Gesetze und Rechtsgüter müssten Gerichte dabei gegeneinander abwiegen, zumal Medienrecht und Polizeigesetze zum Teil auch noch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich seien. Eines sei jedoch klar: Wird ein Journalist*in – oder irgendjemand anderes – von Teilnehmer*innen einer Kundgebung bedroht, ist die Polizei verpflichtet, die Person zu schützen.
Online-Gastgeberin Tina Fritsche, Landesgeschäftsführerin der dju in ver.di Hamburg, wies darauf hin, dass es trotz einer Rechtslage, die eigentlich zu Gunsten der Presse ist, immer wieder zu harten Konflikten mit Polizeieinsatzkräften komme und dass Journalist*innen, die in ver.di organisiert sind, dann auch Rechtsschutz genießen können. Sie sollten nicht zögern, diesen zu nutzen.